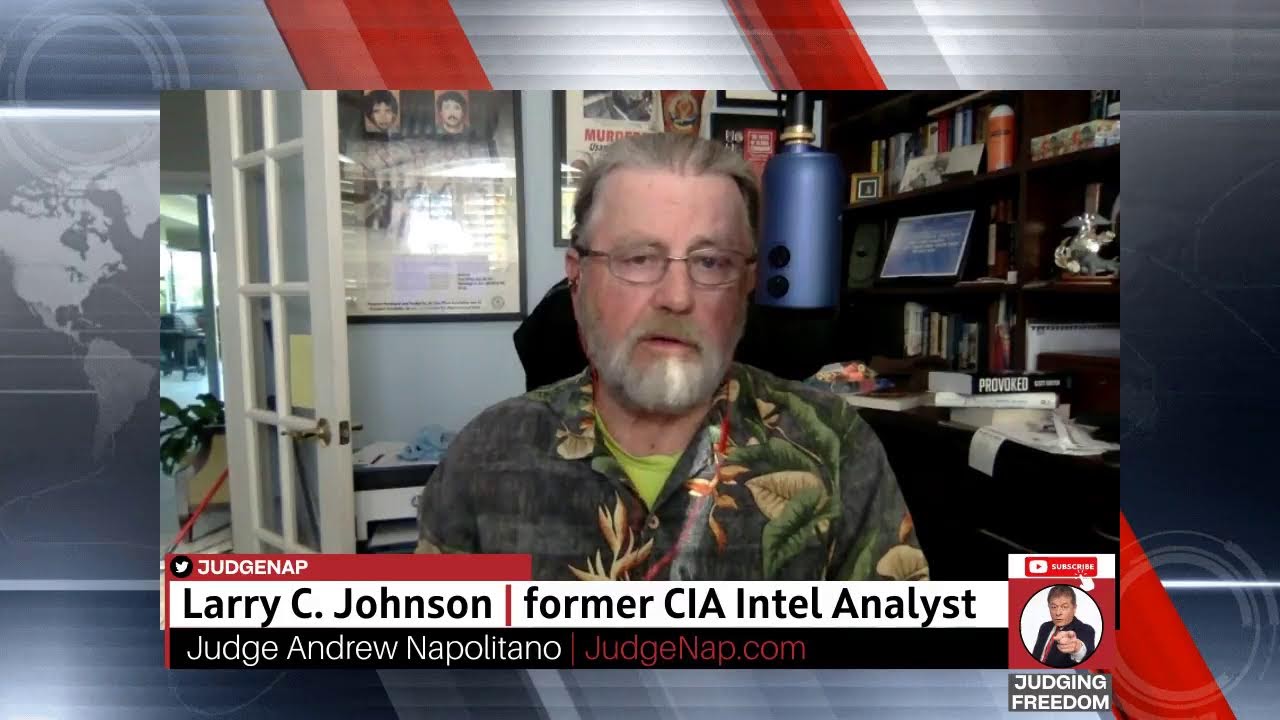Warnungen eines IT-Experten zur E-ID Diese Technologie könnte mehr Kontrolle als Freiheit bringen
Die Einführung der elektronischen Identität, kurz E-ID, wird zunehmend kritischer betrachtet. Der ursprüngliche Versuch, eine solche Identifikation in der Schweiz zu etablieren, wurde 2021 mit einer Mehrheit von 65 Prozent der Stimmen abgelehnt. Dennoch steht nun eine überarbeitete Version in den Startlöchern, die in der Vergangenheit vom Parlament verabschiedet wurde, trotz gegenteiliger Meinungen. Josef Ender, ein IT-Unternehmer mit über 30 Jahren Erfahrung und Präsident des Aktionsbündnisses Urkantone, äußert besorgniserregende Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen dieser digitalen Identitätslösung.
In einem Gespräch mit Hoch 2 erörterte Ender die Gefahren, die mit der E-ID einhergehen, und die damit verbundenen Folgen für die Bürger. Seine kritischen Anmerkungen werfen Fragen auf, die dringend adressiert werden sollten. Bereits im Jahr 2021 hatten viele Bürger Schwierigkeiten, den Nutzen einer E-ID zu erkennen. „Selbst jetzt ist dieser Nutzen nicht erkennbar“, sagt Ender. Die Befürworter der E-ID argumentieren oft mit der Bequemlichkeit, doch es bleibt unklar: Welche konkreten Vorteile bietet die E-ID den Menschen?
In der analogen Welt ist der Bedarf an Ausweisen begrenzt, etwa beim Überqueren von Grenzen oder dem Abholen eines Pakets. Im Internet hingegen existieren keine vergleichbaren Kontrollen. „Warum sollte ich mich also in einem Online-Shop ausweisen müssen?“, fragt Ender zurecht. Auch im beruflichen Alltag ist die Notwendigkeit für die E-ID gering: Wichtige Dokumente wie Rechnungen oder Steuerunterlagen könnten ohne sie digital verwaltet werden. Das Konzept der E-ID wirkt daher überflüssig.
Enders größte Bedenken betreffen die mögliche Verknüpfung der E-ID mit Bankkonten und digitalen Währungen. Sollte eine vollständige Einführung einer digitalen Zentralbankwährung stattfinden, könnte die E-ID als Instrument zur Aufrechterhaltung eines streng regulierten Finanzsystems dienen. „Dann wäre der Übergang zur vollständigen Kontrolle über den Einzelnen nicht mehr fern“, warnt er.
Dies erinnert an Maßnahmen, die während der Corona-Pandemie umgesetzt wurden, als QR-Codes zur Überprüfung des Impfstatus verwendet wurden. Kritiker befürchteten, dass dies eine Gewöhnung an eine Überwachung darstellt, bei der persönliche Freiheiten nur noch mit einer Genehmigung der Behörden gewährt werden.
Besonders alarmierend ist auch die Entscheidung der Schweizer Regierung, heimlich die EU-Variante der E-ID-Technologie zu übernehmen. Diese sieht vor, dass ein eindeutiges Token bei jeder Identitätsnutzung versendet wird und somit eine Nachverfolgbarkeit des Bürgers bei jeder Online-Interaktion ermöglicht. „Das ist ein großer Skandal“, sagt Ender. Diese Entscheidung wurde nicht einmal in den offiziellen Landessprachen kommuniziert, sondern versteckt auf einer englischen Github-Seite.
Ender, der profunde Kenntnisse in IT-Sicherheit hat, betont, dass „Sicherheit nicht nachträglich eingeführt werden kann“. Er sieht die Behauptung, die E-ID sei sicher, als naiv an. Die Hackerangriffe auf komplexe Systeme, wie die der elektronischen Patientenakte in Deutschland, zeigen, dass digitale Systeme verwundbar sind. Wie sicher kann dann eine E-ID sein, die mit sensiblen Informationen verknüpft wird?
Obwohl immer wieder betont wird, dass die Nutzung der E-ID freiwillig sei, zeigt sich bereits jetzt, dass dies irreführend ist. Die Einführung des elektronischen Patientendossiers in der Schweiz fordert genau diese E-ID zur Identifikation. Ein Opt-out ist nur für eine kurze Zeitspanne möglich. „Hier wird aus vermeintlicher Freiwilligkeit schnell ein faktischer Zwang“, bemerkt Ender.
Es gibt bereits jetzt Webseiten, die Nutzer dazu zwingen, Cookie-Zustimmungen zu erteilen, obgleich das Schweizer Gesetz dies nicht verlangt. Ender befürchtet, dass dies auch auf die E-ID übergreifen könnte. Forum- oder Chatbetreiber könnten in naher Zukunft eine Identifikation fordern, um sich rechtlichen Risiken zu entziehen. Dadurch wird der Einzelne durchsichtiger, während Kriminelle nach wie vor Wege finden, sich dem System zu entziehen.
Neben den datenschutzrechtlichen Fragen weist Ender auf die Kosten hin. „Der Bund hat bereits eine Abteilung für die E-ID eingerichtet, obwohl das Gesetz noch nicht in Kraft ist“, kritisiert er. IT-Dienstleister wurden bereits beauftragt, bevor die Bürger überhaupt die Möglichkeit hatten, zu entscheiden. Wozu diese Eile?
Ender hebt hervor, dass nicht alles, was als besonders innovativ verkauft wird, tatsächlich auch nachhaltig ist. Oft sind es teure Fehlinvestitionen, und im Bereich digitaler Identitäten können falsche Entscheidungen bleibende Folgen haben. Eine umfassende öffentliche Debatte über so weitreichende Technologie ist unabdingbar.
„Die E-ID ist kein Zusatznutzen, sondern ein Mittel zur Überwachung und Kontrolle“, warnt Josef Ender. Wer heute glaubt, einfach auf die Nutzung verzichten zu können, könnte schon morgen feststellen, dass essenzielle Dienstleistungen nur noch über die E-ID angeboten werden.
Am 7. März 2025 wird Ender zusammen mit Ständerat Pirmin Schwander und IT-Experte Rolf Rauschenbach eine Informationsveranstaltung in Schwyz organisieren. Zu besprechen wird sein, ob die Schweiz auf diesem Weg fortfahren sollte oder ob Alternativen existieren, um die digitale Zwangsjacke zu verhindern.
Eines ist jedoch klar: Wer sich nicht aktiv gegen die E-ID positioniert, wird bald in einem digitalen System gefangen sein, aus dem es kein Entkommen mehr geben könnte.