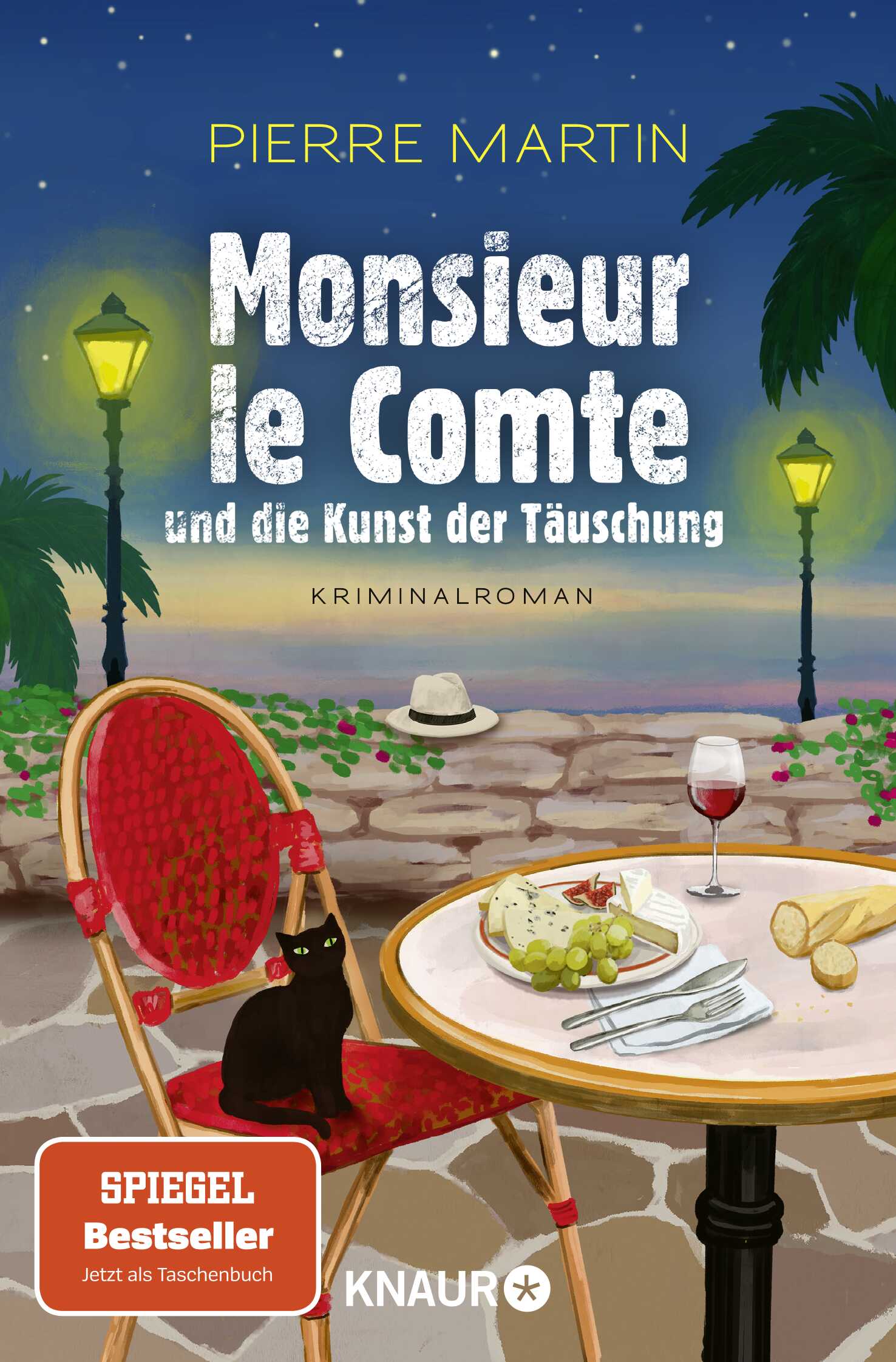Kehrtwende bei Volkswagen und Porsche hin zu herkömmlichen Antrieben
In der Automobilindustrie bahnt sich ein Umdenken an. Volkswagen und Audi hatten ursprünglich den Plan, bis 2033 in Europa keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zu produzieren. Doch jetzt deutet sich eine signifikante Wende an. Das ideologisch motivierte Verbot von Verbrennern scheint in der aktuellen Marktsituation ins Wanken zu geraten.
Der Volkswagen-Konzern, der sich zuvor nahezu ausschließlich der Elektromobilität verpflichtet hatte, sieht sich gravierenden Herausforderungen gegenüber. In Deutschland geht die Nachfrage nach Elektroautos zurück, und auch auf den internationalen Märkten bleibt der Absatz der deutschen E-Autos hinter den Erwartungen zurück. Porsche hat angekündigt, vermehrt in die Entwicklung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu investieren, während auch VW mit einem strategischen Neudenken kokettiert.
Vor nicht allzu langer Zeit wurde Porsche noch als Vorreiter in der Elektromobilitätsbewegung gefeiert. Die Stuttgarter hatten sich hohe Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2030 sollten über 80 Prozent der verkauften Modelle rein elektrisch sein. Doch die Realität hat diese ehrgeizigen Pläne überholt. Insbesondere in China, dem größten Wachstumsmarkt für Autos, brechen die Verkaufszahlen ein, was darauf hinweist, dass die bisherigen Strategien nicht wie gewünscht aufgegangen sind.
Im Jahr 2024 verzeichnete Porsche weltweit nur noch 310.700 verkaufte Fahrzeuge, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von drei Prozent darstellt. In China sind die Verkaufszahlen sogar um 28 Prozent gesunken. So wurden im Jahr 2024 nur noch 56.887 Fahrzeuge verkauft, im Vergleich zu 79.283 im Jahr zuvor. Besonders der Elektro-Taycan verzeichnete dramatische Einbrüche, die Verkaufszahlen lagen bei nur 20.800 Einheiten – ein Rückgang von fast 50 Prozent.
Diese enttäuschenden Verkaufszahlen wirken sich auch erheblich auf die Unternehmensbilanz aus: Im Jahr 2024 musste Porsche einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen. Im dritten Quartal sanken die Erlöse um 6,2 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Noch schwerer wiegt der Rückgang des operativen Ergebnisses, das mit 4,04 Milliarden Euro um 26,7 Prozent gefallen ist.
Die Probleme, mit denen Porsche in China konfrontiert ist, zeichnen sich nicht nur auf regionaler Ebene ab. Der gesamte Konzern sieht sich in seinem einst stärksten Markt, China, mit einem Schwächeanfall konfrontiert. Die Marke VW verkaufte 2024 etwa 2,2 Millionen Fahrzeuge in China, was einen Rückgang von 8,3 Prozent bedeutet. Audi musste sogar einen Rückgang von 10,9 Prozent hinnehmen.
Chinesische Automobilhersteller setzen sich zunehmend durch und gewinnen Marktanteile, da sie in der Lage sind, E-Autos zu einem weitaus günstigeren Preis anzubieten. Über 99 Prozent der börsennotierten Unternehmen in China erhielten direkte staatliche Zuschüsse, wodurch heimische Hersteller einen enormen Wettbewerbsvorteil erlangen.
Das Vertrauen der deutschen Hersteller, dass sie mit Elektrofahrzeugen im globalen Wettbewerb bestehen können, hat sich als Illusion entpuppt. Während Brüssel an den Vorgaben zur E-Mobilität festhält, erkennen auch deutsche Automobilhersteller, dass ein Umdenken notwendig ist: Es wird wieder ein Augenmerk auf die bewährten Technologien gelegt, insbesondere den Verbrennungsmotor. Porsche plant, in Zukunft verstärkt in Entwicklungsprojekte für Verbrennungs- und Plug-in-Hybridfahrzeuge zu investieren.
Für das Jahr 2025 sind Investitionen von 800 Millionen Euro für neue Modelle mit Verbrennungs- und Plug-in-Technologien vorgesehen. Obwohl die Weiterentwicklung elektrischer Antriebe fortgesetzt wird, stehen diese nicht mehr im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Der Trend könnte die gesamte Branche dazu bewegen, ein neues Kapitel auf dem Weg zu einer technologieoffenen Mobilität aufzuschlagen.
Volkswagen und Audi zeigen ebenfalls erste Anzeichen eines Sinneswandels. Laut Berichten überlegen sie, einige Modelle mit Verbrennungsmotor in Europa länger anzubieten als ursprünglich geplant. Erfolgsmodelle wie der Golf, T-Roc oder Tiguan könnten bis mindestens 2035 weiter produziert werden.
Die Öffentlichkeit nimmt den Wandel mit großem Interesse wahr. Während die Zahlen für neu zugelassene Elektroautos in Europa im Jahr 2024 gesunken sind, bleibt die Nachfrage nach Verbrennern stabil. Im Jahr 2024 entfielen 52,4 Prozent aller Neuzulassungen auf Benzin- und Dieselautos, während die Zulassungszahlen für Elektroautos einen Rückgang von über 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zeigten.
Diese Entwicklungen deuten auf einen bevorstehenden Kurswechsel hin, der notwendig scheint, um den Herausforderungen auf dem Automobilmarkt gerecht zu werden. Die deutschen Autohersteller stehen vor der Entscheidung, die bewährte Verbrennungstechnologie wieder in den Fokus ihrer Strategien zu rücken oder weiterhin im Kontext einer unrealistischen Klimapolitik zu verharren.
Die Frage bleibt: Werden weitere Hersteller diesem Trend folgen und sich den aktuellen Realitäten im Automarkt anpassen? Die Zeit wird zeigen, ob die Rückkehr zu etablierten Antrieben tatsächlich der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft der deutschen Automobilindustrie ist.