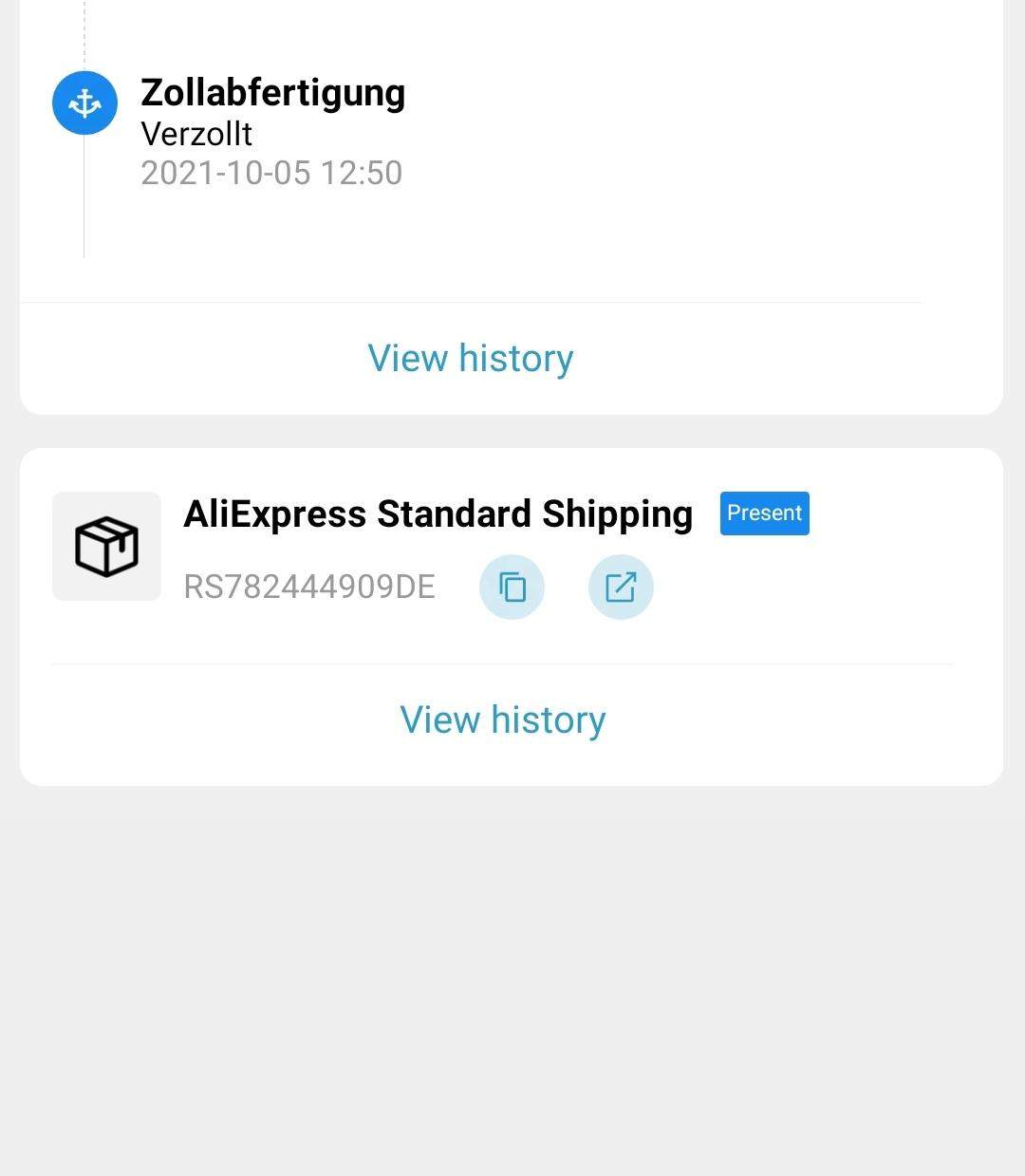Dänemark in der Krise: Herausforderungen der Windkraft und die Wahrheit über die Subventionen
Die grüne Energiepolitik wird oft von Befürwortern als die einzige Lösung angepriesen. Doch in Dänemark wird eine ernüchternde Realität sichtbar: Das Land, das einst wegen seiner Offshore-Windkraft bejubelt wurde, sieht sich zunehmend mit einer Investitionskrise konfrontiert. Die schlechte Nachricht ist einfach: Das Windkraftgeschäft ist ohne massive staatliche Unterstützung nicht tragfähig.
Dänemark kann bis heute 17 Offshore-Windparks vorweisen, die zusammen eine Kapazität von 2,7 Gigawatt haben. Diese Projekte sollten das Aushängeschild der dänischen Energiepolitik sein, doch ihre Zukunft ist nun ungewiss. Besonders bemerkenswert ist das ambitionierte Projekt der „Energieinsel“ in der Nordsee. Geplant war eine künstliche Insel von 460 Hektar, die Windparks mit einer Gesamtleistung von 10 Gigawatt miteinander verbinden sollte. Der ursprünglich für 2030 festgelegte Starttermin wurde auf 2033 und nun sogar auf 2036 verschoben. Der Grund für diese Verzögerungen liegt auf der Hand: Ohne konstante Subventionen sind Investoren nicht bereit, Gelder in ein derart riskantes Projekt zu stecken.
Die Probleme der dänischen Energiepolitik werden durch die recenten Entscheidungen der Regierung noch verstärkt. So wurde kürzlich die zweite Hälfte einer Offshore-Wind-Ausschreibung abgesagt und das Projekt der Energieinsel auf unbestimmte Zeit gestoppt. Dies alles gibt Anlass zur Sorge. Es wird deutlich, dass der gesamte „grüne“ Energiesektor auf einer fragilen Grundlage steht: Ohne staatliche Unterstützung und die gezielte Verteuerung traditioneller Energieträger durch CO2-Steuern könnte diese Branche schon längst nicht mehr existieren. Was als revolutionäre Wirtschaftsentwicklung verkauft wurde, zeigt sich mehr als eine Umverteilung von finanziellen Mitteln von den Verbrauchern und Steuerzahlern hin zu den Unternehmen, die Windkraftanlagen betreiben.
Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass die fast besessene Konzentration auf die Reduzierung von CO2-Emissionen möglicherweise einen teuren Fehler darstellt. Verschiedene Studien belegen, dass der Einfluss zusätzlicher CO2-Emissionen auf das Klima nicht linear ist, sondern logarithmisch abnimmt. Diese Erkenntnisse werden von jenen, die für den Klimaschutz eintreten, oft ignoriert, da sie nicht ins vorherrschende Narrativ passen.
In der derzeitigen Krise reagiert die dänische Regierung auf die Herausforderungen traditionell mit dem beliebten Mittel zusätzlicher Subventionen. Ein neues Förderprogramm soll der taumelnden Windkraftbranche Stabilität verleihen. Energieminister Lars Aagaard äußerte den Bedarf, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das Vertrauen der Investoren zurückkehrt. Diese „Anpassungen“ bedeuten jedoch in der Praxis eine dauerhafte Abhängigkeit von staatlichen Mitteln.
Dänemarks Situation ist ein Warnsignal für all jene, die den Mythos von einer konkurrenzfähigen grünen Energie aufrechterhalten. Dies ist kein kurzfristiges Problem, sondern ein Zeichen für ein gescheitertes Geschäftsmodell, das ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung nicht überlebensfähig ist. Die zentrale Frage ist nicht länger, ob die Windkraftindustrie in Schwierigkeiten ist, sondern wann sie tatsächlich zusammenbrechen wird und welche finanziellen Folgen dies für die Steuerzahler haben könnte.
Während die Politik fortwährend von einer emissionsfreien Zukunft träumt, offenbart die Realität in Dänemark eine andere Geschichte. Das historische Vertrauen in die Windkraft könnte bald bröckeln und es ist an der Zeit, die Energiepolitik an der Realität und nicht an utopischen Vorstellungen auszurichten.