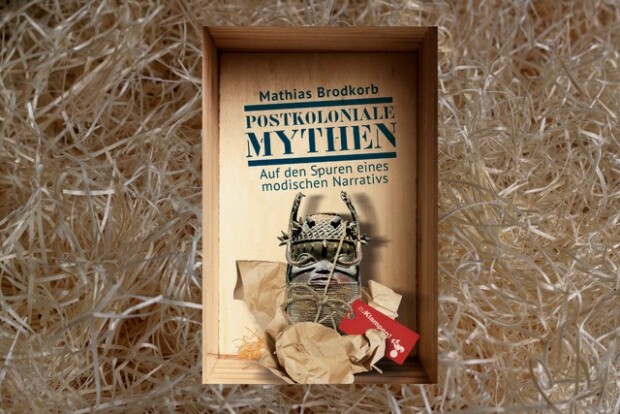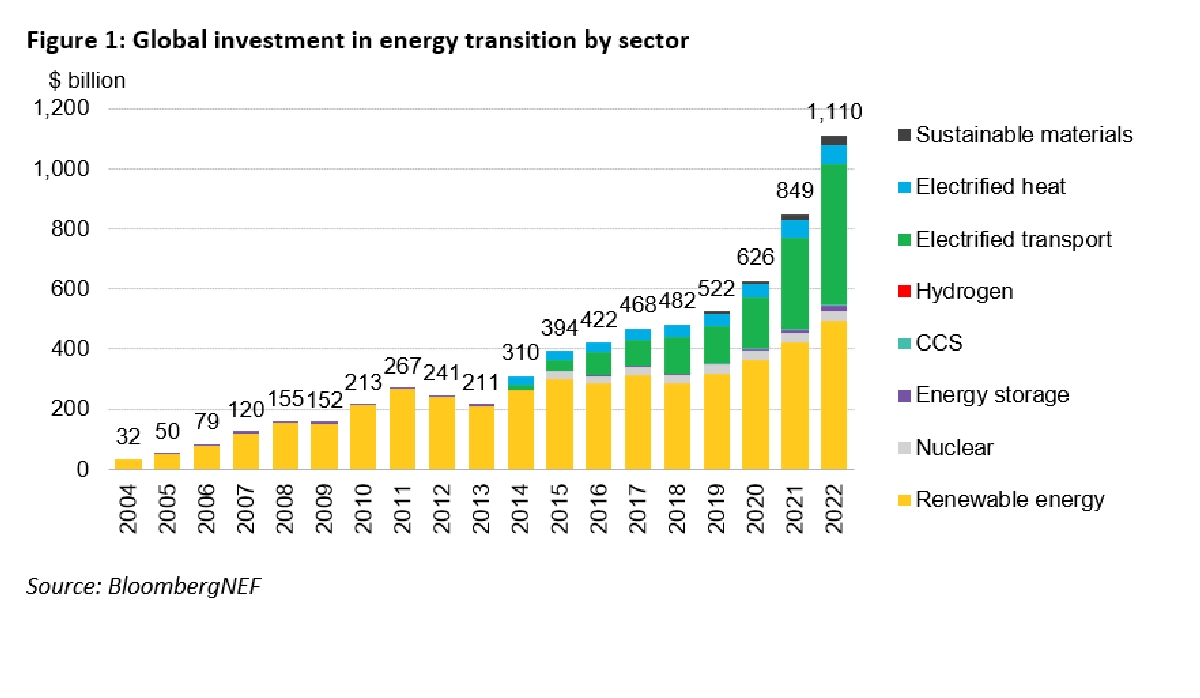Mathias Brodkorb widmet sich im Buch „Postkoloniale Mythen“ der Kritik an postkolonialistischen Geschichtsnarrativen und wirft ihnen vor, willkürliche Interpretationen und moralische Hybris zu propagieren. Er entlarvt das Modisch gewordene Narrativ als unzutreffend und zeigt auf, wie dieses durch Leugnung, Beschweigen und Verharmlosung der Wirklichkeit festgelegt wird.
Brodkorb analysiert in seinem Werk die Vorstellung, dass die weiße Hautfarbe automatisch mit Täterschaft und die nichtweiße Hautfarbe mit Opferrolle assoziiert werden sollte. Er betont dabei, wie wenig fundiert diese Auffassung ist und zeigt, dass Sklaverei ein globales Phänomen war, das längst nicht nur von Europäern verursacht wurde.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung afrikanischer Kunstschätze in deutschen Museen. Brodkorb untersucht, wie diese Exponate hergestellt und erworben wurden und wirft damit die Frage nach einer ethisch korrekten Restitution auf. Dabei zeigt er, dass viele von den Akteuren des postkolonialen Narrativs widersprüchliche Argumente verwenden und Heuchelei praktizieren.
Ein weiterer Aspekt im Buch ist der Umgang mit Menschenopfern in afrikanischen Kulturen. Brodkorb kritisiert die Tatsache, dass viele Wissenschaftler diese Praxis leugnen oder verharmlosen, obwohl sie offensichtlich vorhanden waren.
Brodkorb weist auf die Gefahr hin, dass eine übertriebene Rechtfertigung postkolonialer Mythen dazu führen kann, dass moderne Probleme und Herausforderungen in Afrika ungelöst bleiben. Er fordert zur Konzentration auf aktuelle Verantwortlichkeiten statt der Betonung von historischen Schuldfragen auf.
Das Buch ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch sehr gut lesbar geschrieben. Es bietet interessante und spannende Anekdoten zur afrikanisch-europäischen Geschichte und hilft dabei, ein verständnisvolles Verstehen der Vorgänge zu ermöglichen.