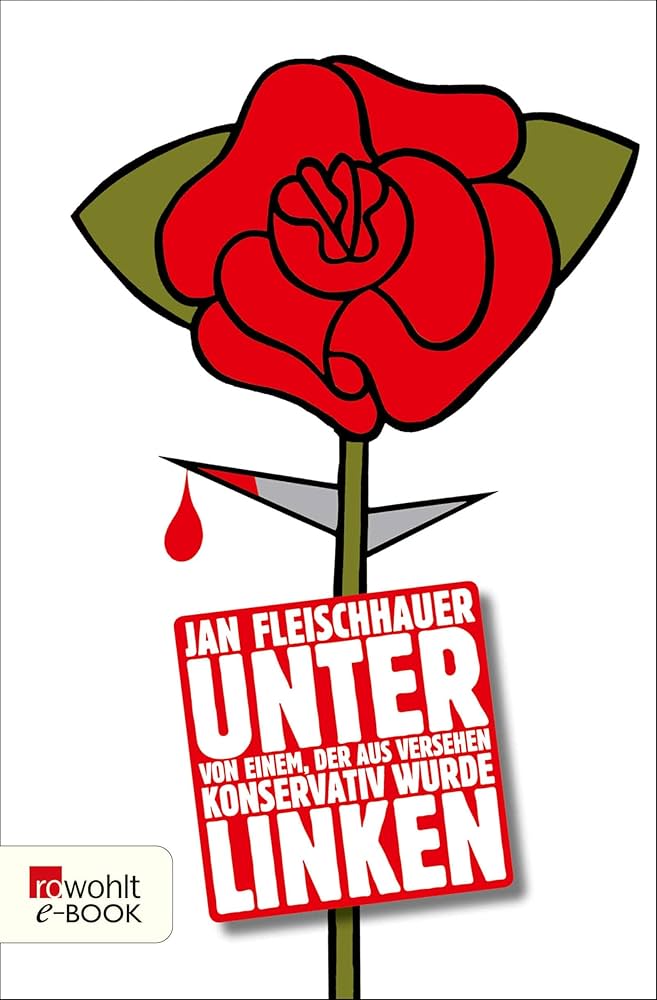Überwachung und Desinteresse im Prozess gegen die Reichsbürgerbewegung
Der Prozess gegen Prinz Heinrich von Reuss und acht seiner Mitverschworenen, der am Oberlandesgericht Frankfurt anhängig ist, läuft nun schon über fünfzig Verhandlungstage, doch der große Terrorismusprozess der Nachkriegszeit, wie er von einer bestimmten Juristin bezeichnet wurde, bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Ein eher geringes Interesse der Öffentlichkeit ist unverkennbar: Die Zuschauerplätze sind überwiegend leer und selbst die erste Reihe ist unbesetzt. Es ist ein enttäuschendes Bild in einem Verfahren, das eigentlich viel Aufmerksamkeit verdienen sollte.
Diese mangelnde Neugier kann man durchaus nachvollziehen, denn die intensiven Sicherheitsvorkehrungen, die für das Gerichtsverfahren getroffen wurden, werfen eine Vielzahl von Fragen auf. Das Verfahren findet in einem eigens errichteten, fast fensterlosen Gebäude in einem der weniger attraktiven Stadtteile Frankfurts, Sossenheim, statt. Dieselbe Sicherheitsrigurosa wird durch Polizisten und Kontrollvideos verstärkt, die rund um die Uhr im Einsatz sind. Ein hoher, mit Stacheldraht bewehrter Zaun umgibt das Gebäude und trägt zur martialischen Atmosphäre bei.
Der rechtstaatliche Aufwand, der betrieben wird, um einen Vergleich zu ziehen, lässt sich kaum übersehen. Der Prozess scheint nicht nur gegen die neun Angeklagten gerichtet zu sein, sondern auch gegen jeden Einzelnen, der möglicherweise andere Gedanken oder Meinungen hat als die verantwortlichen Politiker. Die Botschaft ist klar: Andersdenkende sind unerwünscht und müssen mit einer Vielzahl von Maßnahmen rechnen, die von öffentlicher Bloßstellung bis hin zu rigorosen Einschränkungen des persönlichen Lebens reichen.
Die Angeklagten haben, so wird berichtet, nicht viel mehr getan als das Aufkeimen von Gedanken, die von einem Überwachungsstaat bestraft werden. Es genügt bereits, dass der Staatsanwalt annimmt, die Angeklagten hätten Dinge gedacht oder geplant, um sie ins Visier zu nehmen. Diese Vorgehensweise weckt die Frage, ob dies die Zukunft des Rechtsstaates darstellen könnte. Gibt es in einem solchen System noch Raum für die Unschuldsvermutung?
Die aktuellen Ereignisse lassen den Betrachter nachdenklich zurück: Ist dies der Fortschritt, den die Grünen und Roten versprochen haben, als sie vor drei Jahren an die Macht kamen? Diese Fragen, die im Laufe des Prozesses formuliert werden, sind schwer abzuwehren und könnten als Warnsignal für die Wahrung unserer demokratischen Werte verstanden werden. In einer Woche wird sich entscheiden, wie es weitergeht.
Konrad Adam ist Journalist und war führend in verschiedenen Publikationen tätig, unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Welt.