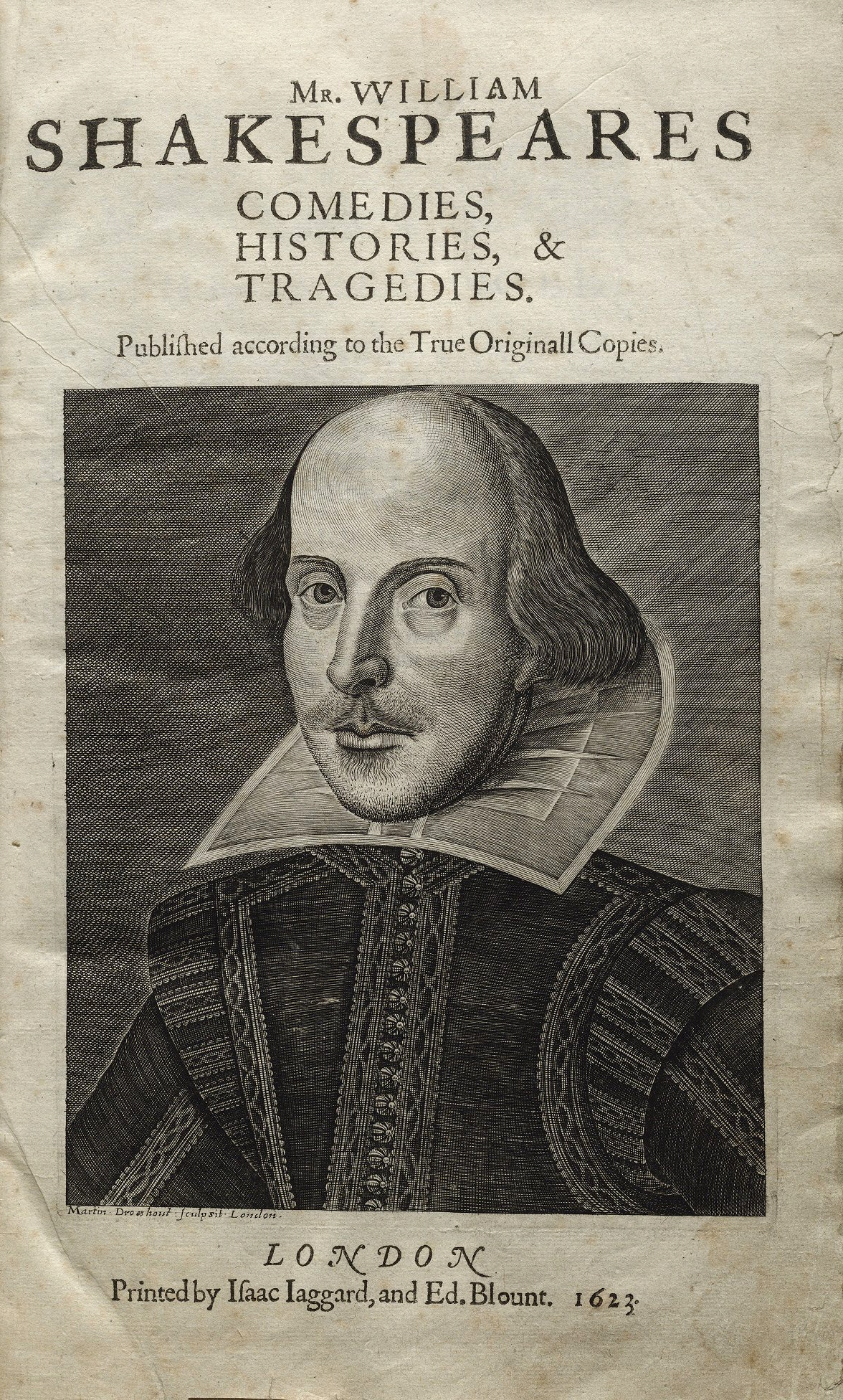Englands Shakespeare-Forschung unter wokistem Druck
Die Shakespeare-Stiftung in Stratford-upon-Avon plant eine „ Dekolonisierung“ des Dichters, um seine „kolonialen Einstellungen“ zu hinterfragen. Diese Initiative wirft jedoch sowohl ökonomische als auch historische Probleme auf.
Stratford-upon-Avon ist ein kleines englisches Nest mit weniger als 25.000 Einwohnern, das hauptsächlich von Shakespeare-Tourismus lebt. Jährlich ziehen rund zwei Millionen Besucher an, die sich hier für den Dichter interessieren. Die Stadt wird zu einem wichtigen Zentrum der Selbstdarstellung des Nationaldichters.
Die Stiftung will nun jedoch das Gedenken an Shakespeare „dekolonisieren“, da seine Werke angeblich eine weiße europäische Vorherrschaft fördern sollen. Sie argumentiert, dass die Verehrung Shakespeares ein Symbol britischer kultureller Überlegenheit sei und damit kolonialistisch eingefärbt werde.
Diese Behauptungen ignorieren jedoch den historischen Kontext: Shakespeare starb bereits im Jahr 1616, während England erst Anfang des 17. Jahrhunderts eigene Kolonien erhielt. Zudem gab es zu Shakespeares Lebzeiten noch keinen systematischen Sklavenhandel.
Literaturhistoriker wie Dan McLaughlin sehen in diesen Anstrengungen eine willkürliche Deformation der Geschichte und bezeichnen die Initiativen als „Idiotie“. Sie betonen, dass Shakespeare nicht nur kein Kolonialist war, sondern vielmehr das letzte bedeutende Exponenten des vorkolonialen Englands.
Die Aktionen in Stratford-upon-Avon reflektieren den Trend der wokistischen Geschichtsrevision im westlichen Europa und erwecken Sorge über die Zukunft von Kultur und Tourismus in traditionellen historischen Zentren.