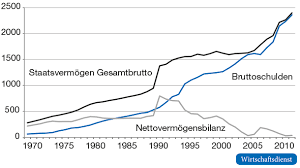Ramadan im Schatten des Karnevals: Eine kritische Betrachtung
Feiern in Zeiten der Unsicherheit
Während in vielen Regionen das bunte Treiben des Karnevals aufgrund erhöhter Sicherheitsbedenken eingeschränkt wird, bleibt der Ramadan ohne nennenswerte Einschränkungen. Dies wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Schieflage im multikulturellen Gefüge unserer Gesellschaft. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul beschreibt den Karneval als Symbol für Toleranz, während er in traditioneller Preußenkleidung an den Feiern teilnimmt. Doch der tatsächliche Umgang mit dem rheinischen Brauchtum zeigt, dass diese Toleranz zunehmend auf die Probe gestellt wird.
In vielen Städten, darunter auch Münster, sind imposante Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, um einem möglichen Terroranschlag vorzubeugen: Überdimensionale Betonpoller sollen verhindern, dass Fahrzeuge ohne Kontrolle in Feiernde rasen. In Gemeinschaften, die nicht über die notwendigen Mittel verfügen oder in denen der Angst vor Anschlägen überwiegt, werden Veranstaltungen und Umzüge abgesagt, wie es beim Kinderkarneval in Nürnberg der Fall war.
Angesichts dieser Bedrohung stellt sich die Frage, ob unsere Gesellschaft diesen Zustand akzeptiert oder ob wir bereits in eine Phase der Resignation eingetreten sind. Die Veränderungen, die unser Land erfahren hat, sind offensichtlich, und selbst Reul ist sich der Gefahren bewusst. Unbeschwertes Feiern ist unter diesen Umständen illusorisch.
Ein ungleicher Vergleich
Im Gegensatz zu den Herausforderungen, die die Karnevalsfeiern begleiten, kann der Ramadan ungestört und mit festlicher Beleuchtung in Städten wie Frankfurt und Köln gefeiert werden. Dieser Aspekt offenbart die Diskrepanz in unserer Gesellschaft: Es geht nicht mehr bloß um das Miteinander und den respektvollen Umgang, viel mehr scheint sich eine Entwicklung abzuzeichnen, die viele als problematisch empfinden. Der Aufstieg des politischen Islams hat dazu geführt, dass heimische Kulturelemente zunehmend in den Hintergrund gedrängt werden, eine Entwicklung, die mit einer offensichtlichen Naivität geduldet wird.
Politische Reaktionen bleiben aus, während einige Politiker der Meinung sind, die Sichtbarkeit des Islams im öffentlichen Raum erhöhen zu müssen. So kündigte die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg an, dass die festliche Beleuchtung in der sogenannten „Fressgass’“ diesen Ramadan „ohne Proteste“ in Betrieb genommen wurde. Doch wenn Deutschland tatsächlich multikulturell wäre, könnte auch der Karneval problemlos unter normalen Bedingungen gefeiert werden, ohne sich vor islamistischem Terror fürchten zu müssen.
Die Situation und ihre Widersprüche
Die aktuelle Situation verstärkt den Eindruck, dass das Problem des Islamismus nicht ernst genommen wird. In einer Kombination aus aufgedrängter Diversität und den offensichtlichen Herausforderungen wird es schwierig, die Probleme adäquat zu adressieren. Während viele Muslime beiderseits des Spektrums von Karneval und Ramadan zehren, zeigen sie keinen nennenswerten Widerstand gegen die wachsende Islamisierung ihrer Umgebung und haben keine greifbaren Lösungen an der Hand.
Die individuelle Integration erfolgreicher Muslime kann die gesamtgesellschaftlichen Missstände nicht kaschieren. Anstatt auf Assimilation zu drängen und die Grundlagen der eigenen Kultur als Basis für ein harmonisches Miteinander zu etablieren, beobachtet man passiv die Entstehung von Parallelgesellschaften, die als „Integration“ verkauft werden. Eine missverstandene Toleranz hat radikale Strömungen begünstigt.
Toleranz ist ein westliches Konzept, das aktiv gefördert werden muss. Die naive Annahme, dass Fremde automatisch die Überlegenheit der hiesigen Gepflogenheiten erkennen, steht im Widerspruch zum stark ausgeprägten Selbstbewusstsein in weiten Teilen der muslimischen Welt. Ein offenes Plädoyer für die Vielfalt wird bald in einer muslimischen Dominanz enden, was der gegenwärtigen politischen Debatte zu entkommen scheint, dabei ist der Beweis des Scheiterns einer gelungenen Integration offensichtlich.
Eine gescheiterte Bilanz
Insgesamt zeigt die gegenwärtige Lage, dass der multikulturelle Ansatz in Deutschland weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Um einen echten Dialog und ein respektvolles Miteinander zu fördern, bedarf es einer aktiven und selbstbewussten Verteidigung der eigenen kulturellen Identität, anstatt einer blinden Akzeptanz des „Anderen“. Letztendlich wird sich erst zeigen, was verloren geht, wenn wir die Grundlagen unserer Identität nicht mehr schätzen.
Zukünftig müssen wir uns intensiver mit diesen Themen befassen und ein Bewusstsein für die Problematik schaffen, anstatt im eigenen Desinteresse zu verharren.