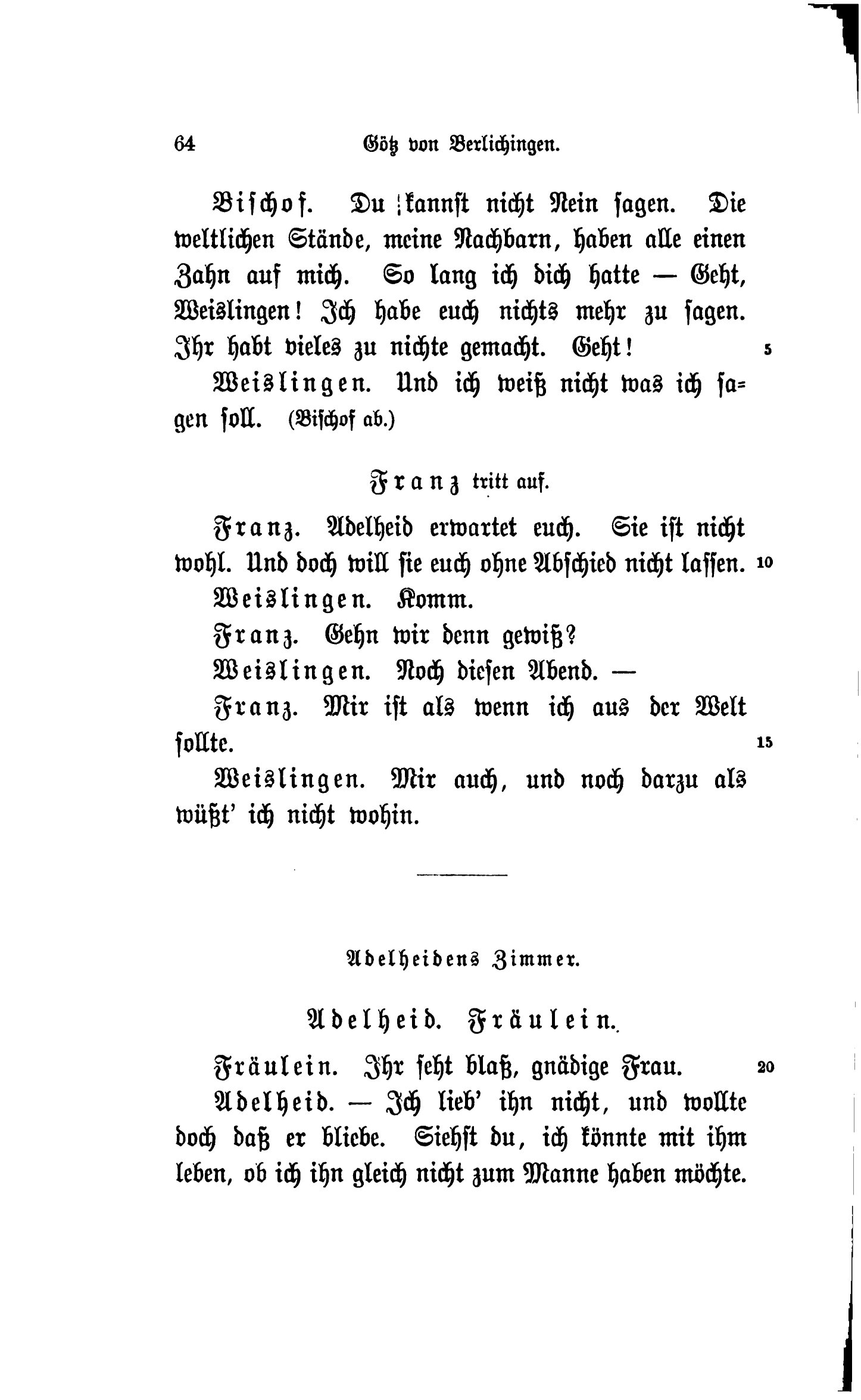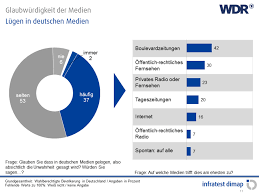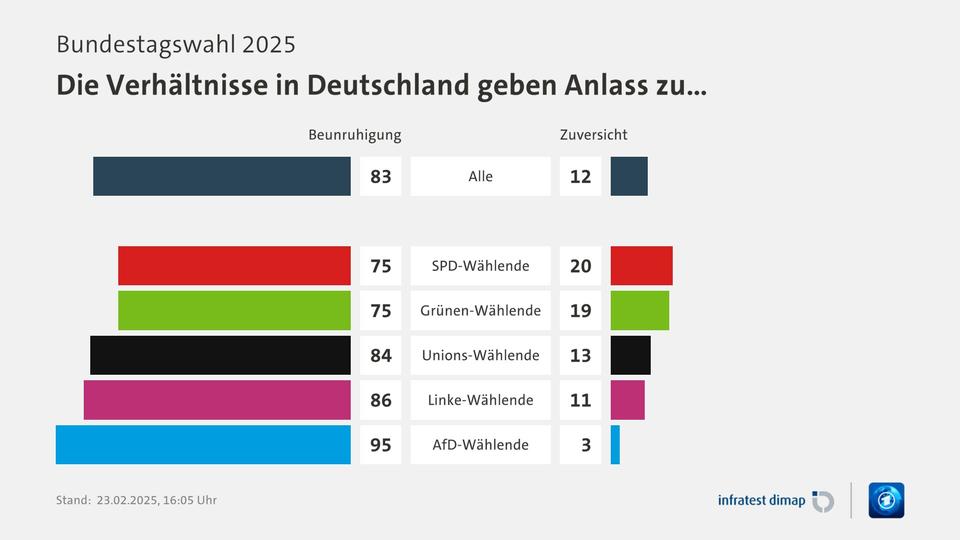Die Rückkehr zur Unparteilichkeit im internationalen Recht
Ted Snider
In der Vergangenheit existierte das Völkerrecht, ein Gefüge aus klaren, codifizierten Normen, das auf den Prinzipien der Vereinten Nationen basierte und auf alle Staaten gleichzeitig Anwendung fand. Doch irgendwann wurde diese grundlegende internationale Rechtsordnung durch eine regelbasierte Ordnung ersetzt. Diese neue Ordnung orientiert sich nicht an einer neutralen Anwendung des Rechts, sondern wirkt selektiv, wobei die Vereinigten Staaten und ihr Gedanke von Ausnahmestellung im Mittelpunkt stehen. Hinter der Maske der vermeintlichen Universalität agieren die USA nach eigenem Gutdünken, indem sie Regeln anwenden, die ihnen nützen, und sich von jenen abwenden, die ihnen nicht genehm sind. Richard Sakwa beschreibt diesen gravierenden Wandel als „große Substitution“, bei dem die ungeschriebene regelbasierte Ordnung die bisher kodifizierten internationalen Gesetze verdrängte.
Einst waren die USA auf den Anschein des Völkerrechts angewiesen, um ihre Macht zu legitimieren. Man verstand, dass der Eindruck von Unterstützung durch die UNO und die internationale Gemeinschaft für die eigene Stärke entscheidend war. Operationen, die unter dem Deckmantel humanitärer Interventionen stattfanden, und Umstürze, die als Demokratieförderung dargestellt wurden, waren Teil dieses Spiels. Die Enthüllung dieser Taktiken gelang jedoch durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Er brach ungeniert mit den Grundsätzen des Völkerrechts und zeigte damit die wahre Natur der internationalen Ambitionen der USA.
Bereits in einer Pressekonferenz am 4. Februar kündigte Trump an: „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch dort unsere Arbeit machen. Wir werden ihn besitzen und … das Gelände dem Erdboden gleichmachen und die zerstörten Gebäude beseitigen, dem Erdboden gleichmachen. Eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen, die den Menschen in der Region unbegrenzt viele Arbeitsplätze und Wohnraum bietet.“
Die New York Times kritisierte, dass Trump keinen Rechtsanspruch vorweisen konnte, der den Vereinigten Staaten einseitig die Kontrolle über fremdes Territorium gestatten würde. Zudem wäre die gewaltsame Vertreibung einer gesamten Bevölkerung ein klarer Verstoß gegen internationales Recht. Gerade der Präsident, der zuvor seine Vision eines Friedens durch die Beendigung von Kriegen in Aussicht stellte, ignorierte dermaßen unverfroren die bestehenden Normen.
Trumps Absicht, „Menschen dauerhaft umzusiedeln“, könnte nicht nur die Entsendung amerikanischer Truppen im Bedarfsfall bedeuten, sondern auch zu einem erschütternden Konflikt in der gesamten Region führen. Und obwohl er betonte, dass es sich nicht um eine leichtfertige Entscheidung handele, ist sie ein direkter Widerspruch zu seinem Traum von den Abraham-Abkommen und der diplomatischen Beziehung zu Saudi-Arabien, die deutlich machte, dass ohne einen palästinensischen Staat keine Gespräche über eine Partnerschaft mit Israel geführt werden können. Das hypothetische amerikanische Immobilienprojekt verletzt die Prinzipien, die einen palästinensischen Staat begründen.
Trumps aggressive Rhetorik beschränkt sich nicht nur auf den Gazastreifen. Er äußerte auch vehemente Wünsche bezüglich Kanadas, indem er die „wirtschaftliche Gewalt“ ins Spiel brachte, um „diese künstlich gezogene Grenze“ zwischen den USA und Kanada in Frage zu stellen und sogar zu überlegen, Kanada als den 51. Bundesstaat zu integrieren. Trotz seiner Behauptungen über gleichzeitigige Bedrohungen, zeigen Statistiken, dass der Anteil Kanadas an der Fentanyl-Zufuhr in die USA minimal ist und Umfragen ergeben, dass eine klare Mehrheit der Kanadier einen solchen Staatseintritt ablehnt.
Auch über Grönland äußerte er sich militaristisch und ließ die Möglichkeit offen, militärische Gewalt nicht auszuschließen. Seine Einlassungen über die Bedeutung des Panamakanals führten zu Spekulationen über die Anwendung amerikanischer Gewalt zur Erlangung der Kontrolle über diese strategische Wasserstraße.
Die USA haben bereits einen Krieg gegen Panama geführt, obwohl das Land nicht aggressiv handelte. Zuletzt zeigt sich, dass die USA ihre neo-kolonialen Ambitionen offenbaren. Wenn diese imperialistischen Bestrebungen mithilfe eines impulsiven Präsidenten wie Trump zur Schau gestellt werden, läuft die amerikanische Hegemonie Gefahr, nicht nur Schwächung durch Abkehr von alten Allianzen, sondern auch den Verlust ihres Einflusses in der Welt insgesamt zu erleben.
Es bleibt fraglich, wer mit den USA Verträge abschließen würde, nachdem Trump das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt hat. Ebenso stellt sich die Frage, ob sich andere Staaten dazu bereit erklären werden, die USA als bevorzugten Wirtschaftspartner anzuerkennen, wenn deren Präsident sich mit seinen engen Nachbarn wie Kanada in einen Konflikt begibt, und dann die Sicherheitspartner wie Dänemark militärisch unter Druck setzt. Wenn die US-Hegemonie selbst gegen ihre Verbündeten und bestehende internationale Ordnungen vorgeht, könnte sie letztendlich die Führungsposition in der Welt verlieren.