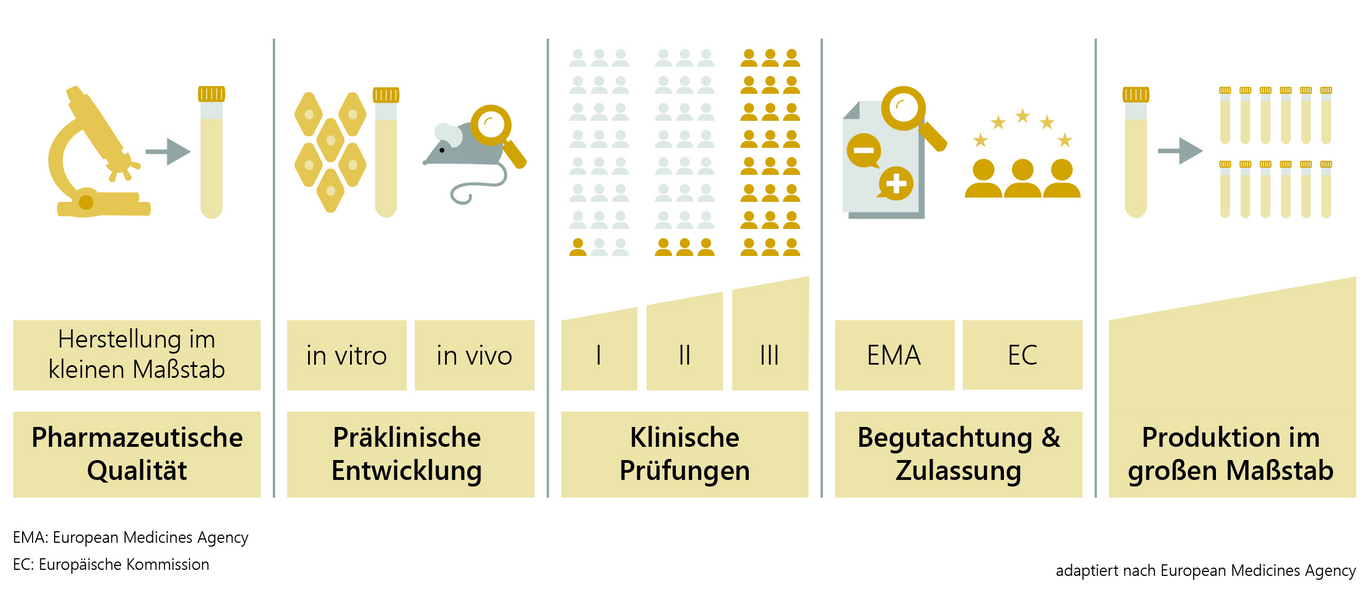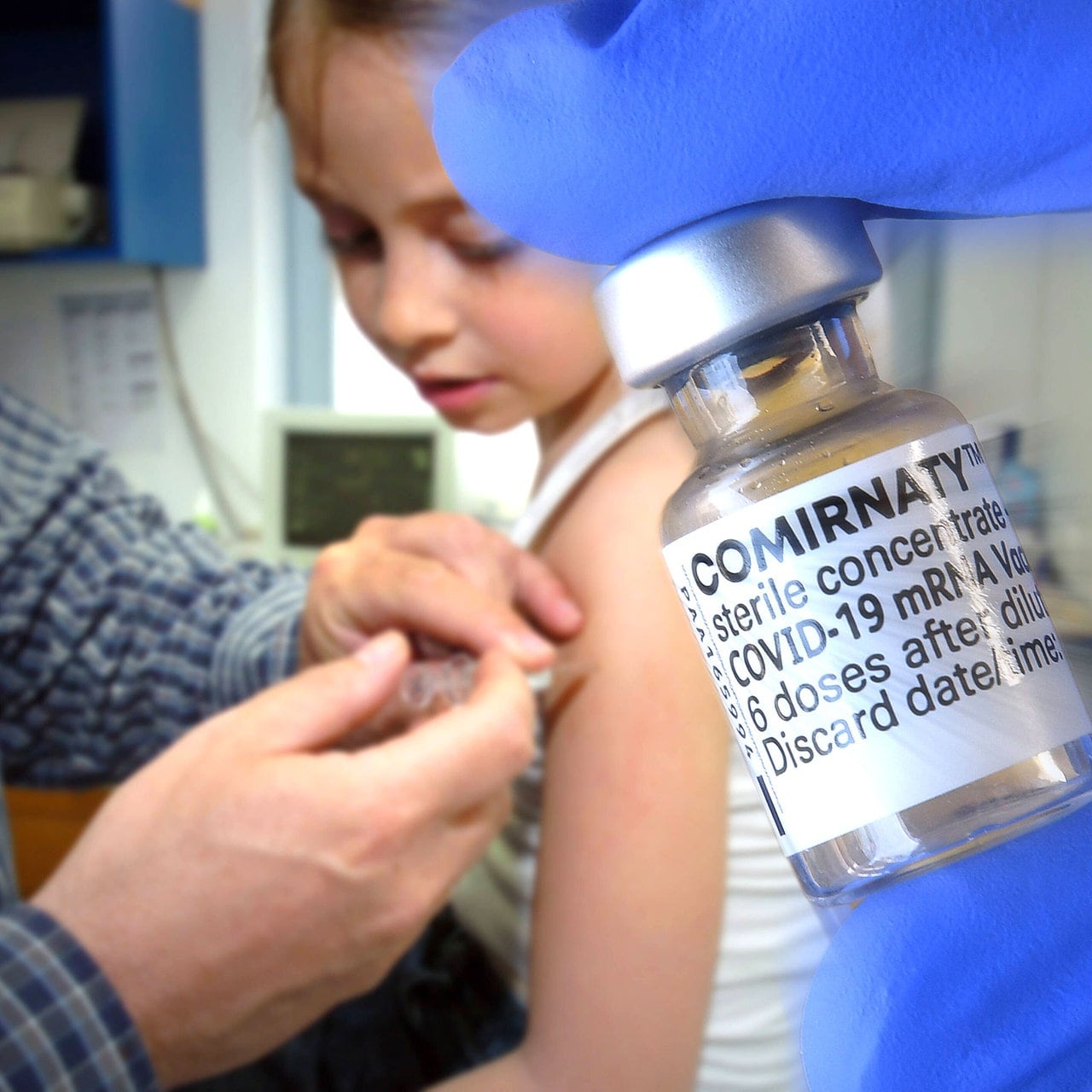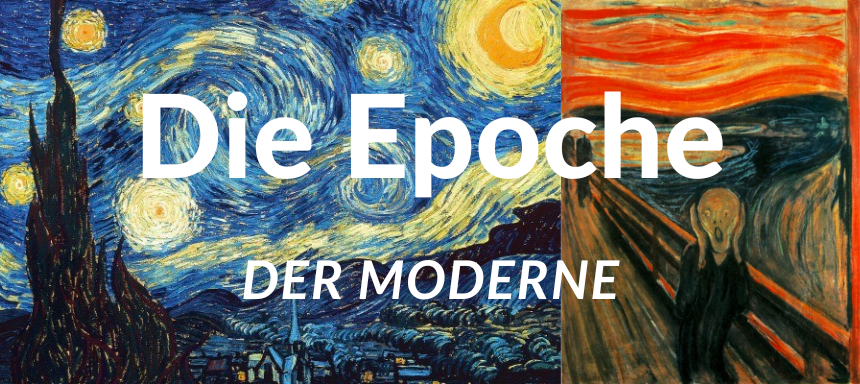Gewinnrückgang bei Mercedes-Benz: Herausforderungen der Elektrostrategie
Im letzten Jahr erlebte der Stuttgarter Automobilhersteller Mercedes-Benz einen erheblichen Rückgang seines Gewinns. Diese Information entstammt einer aktuellen Veröffentlichung des DAX-notierten Unternehmens. Die Elektrostrategie des Herstellers hat insbesondere auf den Märkten in Deutschland und China zu spürbaren Absatzverlusten geführt.
Für das Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen einen brutalen Gewinnrückgang von 28 Prozent, was das Konzernergebnis auf 10,4 Milliarden Euro sinken ließ. Der Umsatz fiel ebenfalls um 4,5 Prozent auf 145,6 Milliarden Euro. Hauptgrund für diese schlechten Zahlen ist die anhaltende Absatzkrise. Weltweit konnte Mercedes-Benz nur noch etwa 2,4 Millionen Fahrzeuge absetzen, was einem Rückgang von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars erlitt dabei einen Rückgang von 3 Prozent auf 1,98 Millionen verkaufte Fahrzeuge.
Besonders alarmierend ist die drastische Verkaufsdelle auf dem chinesischen Markt, der für Mercedes und die gesamte deutsche Automobilindustrie von zentraler Bedeutung ist. Dort gingen die Neuzulassungen dramatisch zurück. Statista berichtet, dass die Verkaufszahlen von Mercedes-Fahrzeugen in China im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent sanken. Auch in Europa musste das Unternehmen Einbußen hinnehmen, der Absatz fiel um 2,8 Prozent.
Ein Hauptursache für den weltweiten Rückgang sind die enttäuschenden Verkaufszahlen der elektrischen Modelle, die die Bilanzen erheblich belasten. Im vergangenen Jahr konnte Mercedes nur noch 185.100 vollelektrische Fahrzeuge absetzen, was einem Rückgang von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders dramatisch wirkte sich der Rückgang im vierten Quartal aus, wo die Verkaufszahlen um 26 Prozent einbrachen.
Zwei Hauptgründe tragen dazu bei, dass deutsche Elektroautos in China kaum noch Käufer finden. Der erste Grund ist die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der chinesischen Konkurrenz, die von beträchtlichen staatlichen Subventionen und niedrigen Produktionskosten profitiert. Deutsche Hersteller hingegen kämpfen mit hohen Produktionskosten und müssen sich auf einem Markt zurechtfinden, der von chinesischen Firmen dominiert wird, die Zugang zu günstigen Rohstoffen haben.
Ein zweiter Grund liegt in der schwächelnden Konjunktur Chinas. Während das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 5 Prozent wuchs, ist dies im historischen Vergleich niedrig. Umso mehr geraten hochpreisige deutsche Modelle unter Druck. Mercedes-Benz, unter der Leitung von Ola Källenius, hat die Elektrostrategie und eine Luxusstrategie verfolgt, die jedoch in der aktuellen wirtschaftlichen Lage Käufer von teureren Fahrzeugen abgeschreckt hat. Wohlhabende Käufer in China neigen eher zu preisgünstigeren Modellen lokaler Hersteller, die vielfach fünf- bis zehnmal günstiger sind.
In Deutschland ist der Rückgang ebenfalls eng mit dem Wegfall des Umweltbonus verbunden, der in den letzten Jahren eine künstliche Nachfrage nach Elektrofahrzeugen geschürt hat. Über einen Zeitraum von sieben Jahren flossen hierzulande 10 Milliarden Euro an Fördermitteln. Diese Unterstützung schuf eine Abhängigkeit vom staatlichen Zuschuss, sodass nun ein wesentlich geringeres Interesse an Elektroautos festgestellt werden kann.
Ein weiteres Problem liegt in der unzureichenden Ladeinfrastruktur in Deutschland, wo nicht genügend öffentliche Ladestationen vorhanden sind – etwa 130.000 für 1,7 Millionen Elektrofahrzeuge. Um die Umstellung auf Elektromobilität tatsächlich verwirklichen zu können, wäre laut des Bundesverbandes der Ausbau von 450.000 weiteren öffentlichen Ladestellen sowie 17 Millionen privaten Ladesäulen bis 2030 erforderlich.
In Anbetracht der nationalen und internationalen Herausforderungen sieht sich Mercedes gezwungen, zu sparen. Ola Källenius, der CEO, kündigte kürzlich an, dass die Produktionskosten bis 2027 um 10 Prozent gesenkt werden sollen. Auch die Belegschaft wird um einen Beitrag zum Sparprogramm gebeten. Der Betriebsrat stellte den gegenwärtigen Mitarbeitern eine „Horrorliste“ von Maßnahmen vor, die unter anderem Kürzungen bei Erfolgsprämien und Streichungen von Jubiläumszuwendungen umfasst. Letzteres könnte dem Unternehmen rund 450 Millionen Euro sparen.
Zudem könnte es trotz einer aktuellen Beschäftigungsgarantie, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 ausschließt, zu Stellenabbau kommen. Offizielle Informationen dazu liegen momentan jedoch nicht vor.
Die Situation ist unbeständig: Der anfängliche strategische Fehltritt von Mercedes, der stark auf Elektromobilität fokussiert war, überträgt sich nun auf die Belegschaft. Doch die Krisenursache ist nicht ausschließlich hausgemacht. Hohe Energiepreise, ansteigende Bürokratie und die strengen Klimavorgaben der EU und der scheidenden Bundesregierung tragen ebenfalls dazu bei, dass das Produktionsumfeld in Deutschland ungünstig erscheint.
Infolgedessen verlagert Mercedes-Benz nun verstärkt Produktion ins Ausland, um den ungünstigen Gegebenheiten in Deutschland zu entkommen. Mit einer Investition von rund 1,5 Milliarden Euro wird das Werk im ungarischen Kecskemét ausgebaut, welches zum größten Autofertigungsstandort des Landes werden soll. Die Betriebskosten in Ungarn sind etwa 70 Prozent niedriger als in Deutschland, was eine erhebliche Entlastung darstellt. Im neuen Werk sollen sowohl konventionelle als auch Elektro- und Hybridfahrzeuge produziert werden, mit einer geplanten Produktionsaufnahme noch in diesem Jahr.
Die bundesdeutsche Politik wird wohl nur bedingt mit dieser Produktionsverlagerung einverstanden sein. Ironischerweise expandiert Mercedes-Benz in Ungarn zu einer Zeit, in der es aufgrund politischer Spannungen zwischen der EU und der ungarischen Regierung unter Viktor Orbán kritische Auflagen gibt. Trotz ihrer ideologischen Differenzen zeigt sich, dass Orbán in Ungarn hohe Zustimmungsraten genießt.
Mercedes-Benz steht also vor einem Dilemma: Ein Rückgang der Verkaufszahlen, schrumpfende Margen und ein zunehmend unattraktiver Standort in Deutschland. Hohe Produktionskosten, drakonische Bürokratie und klimapolitische Vorgaben treiben Unternehmen dazu, das Land zu verlassen, und Ungarn profitiert von dieser Entwicklung. Der Verfall des deutschen Produktionsstandorts ist unübersehbar: Wer hierzulande weiterhin produziert, muss entweder außergewöhnlich belastbar sein oder einen soliden Plan für eine mögliche Flucht in Erwägung ziehen.