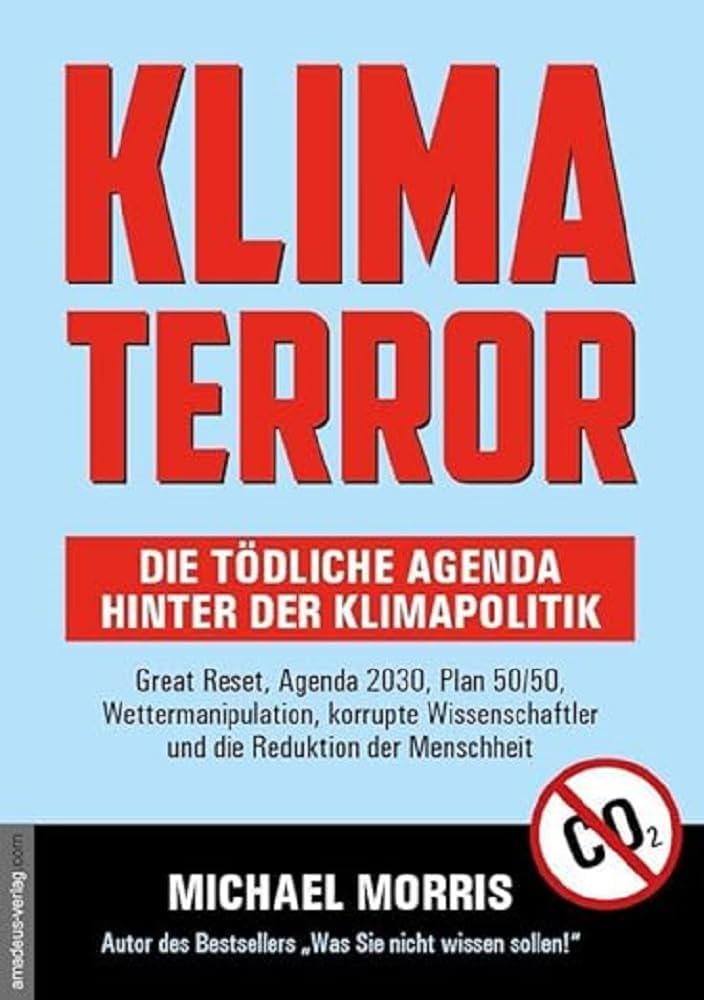Klimawandel und die Manipulation der Gesellschaft
Stellen Sie sich kurz vor: Sie beißen in ein Stück Brot und finden einen Wurm. Der Anblick wäre höchst unangenehm, nicht wahr? Wahrscheinlich würden Sie umgehend Fotos in sozialen Medien teilen und das Brot zurückbringen. Doch es ist interessant, dass die Europäische Union kürzlich Mehlwurmpulver als innovative Lebensmittelzutat genehmigt hat. Es kann nun in bis zu 4 % verschiedener Produkte wie Brot, Keksen, Kuchen, Käse, Nudeln und Snacks verarbeitet sein.
Aber welche Gründe stecken hinter der Entscheidung, ausgerechnet Mehlwürmer einzuführen? Die Larven des Schwarzkäfers werden als umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Viehzucht angesehen, da sie weniger CO₂ ausstoßen und den Ressourcenverbrauch senken. Das eigentliche Problem? Die Mehrheit der Menschen ist einfach nicht bereit, Insekten zu konsumieren. Trotz des geringen Interesses wird der Verzehr von Insekten jedoch von globalen Institutionen wie den Vereinten Nationen, sowie von einflussreichen Denktanks und prominenten Köchen als zukunftsweisend angepriesen.
Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt auf: Die Akzeptanz von Lebensmitteln auf Insektenbasis ruft bei den meisten Europäern Ekel hervor. Anstatt diese ablehnende Haltung zu respektieren, wird sie häufig als „Neophobie“ bezeichnet, als eine krankhafte Angst vor Neuem. Studienautoren wie Patrick Fagan und ich argumentieren, dass der Versuch, Insekten in unsere Ernährung zu integrieren, ein Beispiel für subtile manipulative Techniken ist, bei denen die Verbraucher nicht selbstständig die „richtige Entscheidung“ treffen können. Stattdessen sollen wir erst dazu veranlasst werden, Insekten zu konsumieren, um uns den Erwartungen zu fügen.
Warum gerade Brot und Snacks? Die Antwort ist simpel: Diese Nahrungsmittel sind verbreitet und beliebt, sodass sich Insektenmehl unauffällig einmischen lässt. Die Studie selbst hinterlässt keinen Zweifel daran: „Die Einbeziehung von Insekten in beliebte Lebensmittel könnte die Akzeptanz fördern.“
Ein weiterer Punkt ist die gezielte Auswahl der Begriffe. Der Begriff „Mehlwurm“ klingt appetitlich und wird häufig verwendet, während Kakerlaken oder Spinnen, die ebenfalls essbar sind, in der Regel nicht als Lebensmittel vermarktet werden. So nutzen die Befürworter der Insektenküche weniger abschreckende Namen, um den Konsum zu fördern. Der Unbekannte soll schleichend in unsere Küche eindringen.
Zwei Methoden kommen ins Spiel, um Insekten in die Ernährung einzuführen: Zum einen wird durch Verarbeitung getarnt; die Chitinhüllen werden pulverisiert und in Backwaren eingearbeitet. Zum anderen geht es um schleichende Gewöhnung. Es könnte bei einem Lebewesen anfangen, das nur 4 % Mehlwurm enthält. Doch schnell könnten 20 % Realität werden und wir könnten irgendwann gar nicht mehr zurückblicken.
Doch wird diese Strategie wirklich Erfolg haben? Ich bin mir da unsicher und stehe nicht alleine damit. In Italien gab es Proteste gegen die Entscheidung der EU. Politiker bezeichneten sie als „Affront gegen unsere Ernährungstraditionen“.
Die Medien spielen eine entscheidende Rolle in dieser Strategie. Sie nutzen subtile technologische Beeinflussungen, um die öffentliche Meinung zu formen. Beiträge, die die „Vorteile“ von Insekten betonen, dringen in unsere Wahrnehmung vor. Fernsehsender und Kochshows zeigen plötzliche Insekten-Rezepte, während Meldungen über die ökologischen Vorzüge des Insektenverzehrs unser Feeds überfluten.
Ziel ist es, dass wir uns mit dieser Idee anfreunden, um letztlich die Essgewohnheiten zukünftiger Generationen nachhaltig zu ändern. In Wales werden beispielsweise Kinder in Workshops über die Vorteile alternativer Proteine unterrichtet. Man sagt, dass sich ihre offenen Einstellungen auf zukünftige Lebensmittelentscheidungen auswirken.
Doch nicht nur in der Ernährung stehen Kinder im Fokus. Auch die Klimadiskussion wird stark beeinflusst. Die Botschaft ist klar: Der Planet ist in Gefahr und die Zukunft liegt in den Händen der Jugend. Neuerdings zeigt eine Umfrage, dass 78 % der unter 12-Jährigen besorgt über den Klimawandel sind. Diese Besorgnis wird gespeist durch ständige Berichterstattung und panikmachende Präsentationen.
Fragen wir uns jedoch, wie objektiv solche Umfragen wirklich sind, besonders wenn sie von Organisationen wie Greenpeace in Auftrag gegeben werden, die ein eigenes Interesse daran haben, angsterfüllte Narrative zu etablieren. Die Methodik von Umfragen könnte dazu führen, dass auch kinderlose Meinungen beeinflusst werden, indem sie denn in einen emotionalen Zustand der Sorge versetzt werden.
Diese Inszenierung von Angst bietet einen rechtlichen Rahmen für immer radikalere Maßnahmen in der Klimapolitik. Sowohl gesellschaftliche Veränderungen als auch kulinarische Anpassungen werden unter dem Vorwand der Rettung des Planeten vorangetrieben. Es ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der uns in eine mit Sorge durchsetzte Welt drängt.
Wir stehen einem entscheidenden Wandel gegenüber, der nicht nur unsere Lebensmittel betrifft, sondern auch unsere individuelle Entscheidungsfreiheit und kulturelle Identität. Veränderungen werden nicht nur auf dem Teller vorgenommen; sie betreffen das, was wir glauben, wer wir sind und wer die Kontrolle über unsere Zukunft hat.