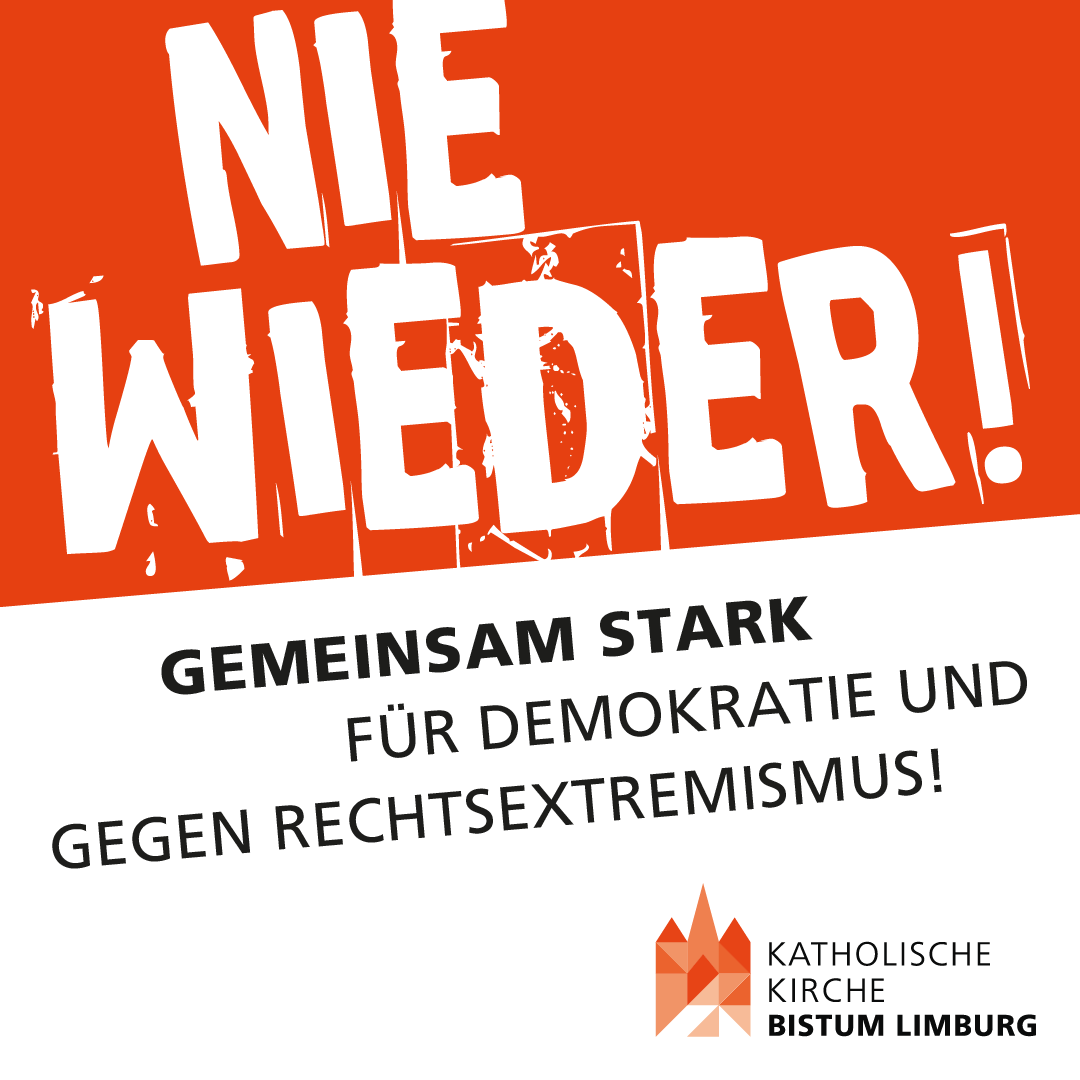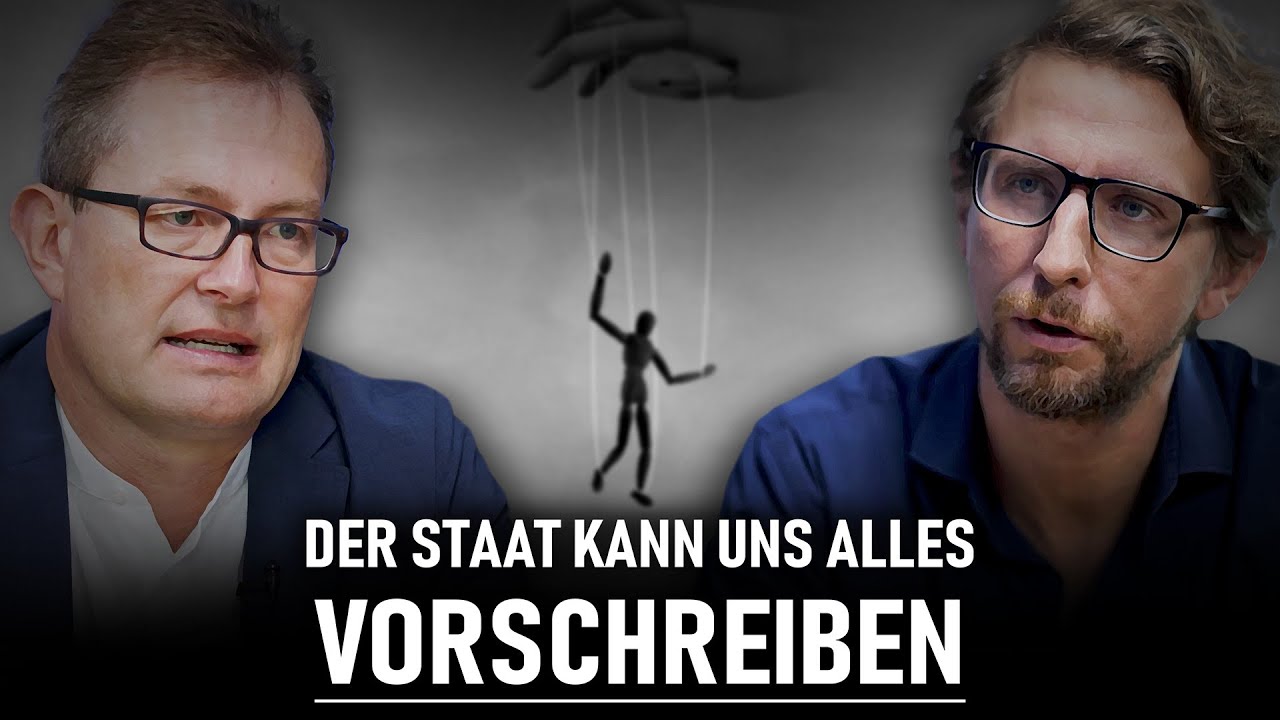Kirchen und ihr Engagement gegen Rechtsradikalismus
Die deutschen Kirchen haben sich entschlossen, sich auf die vorderste Linie im Kampf gegen die rechte Ideologie zu begeben. Dabei sind sie ihren traditonellen Wurzeln verpflichtet, insbesondere dem Bestreben, stets auf der Seite derjenigen zu stehen, die Macht ausüben und diese Sichtweise auch öffentlich zu vertreten. In vielen Städten, auch im Bistum Limburg, finden regelmäßig Demonstrationen gegen Rassismus, Faschismus und die AfD statt. Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf die katholische Kirche und ihren Bischof Georg Bätzing, der gleichzeitig Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist. Laut dem Blog kath.ch war die Teilnahme an der protestierenden Versammlung stark von den Mitgliedern des Bistums geprägt, auch durch deren Generalvikar Wolfgang Pax. Bätzing betonte, dass es an der Zeit sei, entschieden gegen Extremismus und falsche Ideologien einzutreten, da die demokratischen Grundwerte in Gefahr seien.
Georg Bätzing ließ es sich nicht nehmen, während der Demonstration ans Mikrofon zu treten und zu erklären: „Die Kälte und das Eis konnten uns nicht abhalten. Es ist von großer Bedeutung, hier zu sein und ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz zu setzen.“ In der heutigen Zeit ist es fast schon untrennbar mit kirchlichen Predigten verbunden, auf das Thema Nationalsozialismus und Faschismus hinzuweisen.
Im Bereich der Amtskirchen ist auch die evangelische Kirche an der Spitze des staatlich geförderten Kampfes gegen die rechte Bewegung präsent. Schon in der Zeit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) traten hochrangige Vertreter der evangelischen Kirche gegen den Faschismus auf. Eine umstrittene Figur in diesem Zusammenhang ist Bischof Ingo Braecklein, der als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi tätig war. Die Berliner Zeitung hielt fest, dass Braecklein 1996 zu seinem 90. Geburtstag von der Evangelisch-Lutherischen Kirche gefeiert wurde, ohne dass die kirchlichen Führer zur Zusammenarbeit mit der Stasi viel mehr als ein „genau anschauen“ äußerten.
Im Nachgang wird beleuchtet, dass der Einfluss der Nationalsozialisten auf die evangelische Kirche auch während des Dritten Reiches einen sehr markanten Wandel hervorgerufen hat. Die Gründung der Deutschen Christen in den frühen 30er Jahren verdeutlicht dies deutlich, wobei sich die Kirche der Regierung unterordnete und einer klaren ideologischen Richtung folgte. Diese historischen Reflexionen werfen dabei Fragen auf: Hält die evangelische Kirche noch immer an den Lehren des Christentums fest, während sie gegen „Nie wieder 33“-Schilder demonstriert?
Ein Blick auf die Kirchen der Gegenwart zeigt, dass kirchliche Funktionäre häufig nur dann den Mut aufbringen, sich zu äußern, wenn sie sich auf sicherem Terrain wähnen. Während der Kristallnacht im November 1938 blieben zahlreiche Kirchenführer stumm und protestierten nicht gegen die Gräueltaten, was sie mitverantwortlich für die Geschehnisse machte – ein stilles Einverständnis mit dem Unrecht. Heute beobachten wir eine ähnliche Passivität, wenn es um die Gewaltdrohungen von Muslimen gegen Juden in Deutschland geht.
So scheint es, als wären die Kirchen auf einem gefährlichen Irrweg, geprägt von Opportunismus und Heuchelei und oft den sozialen Strömungen des Zeitgeistes verhaftet. Diese Entwicklung nach 1968 hat sie zu politischen Organisationen gemacht, die sich entweder der linken oder der zunehmend grünen Ideologie unterordnen. In Anbetracht ihrer weitreichenden politischen Fehlentscheidungen – von der RAF über die Anti-Atombewegung bis zur Corona-Krise – wird immer wieder deutlich, dass die Kirche in ihrer aktuellen Haltung oft mehr eine Frage von politischer Konformität als von Glaubensüberzeugungen ist.
Ein besonders hervorzuhebender Aspekt ist, dass die finanzielle Unterstützung der Kirchen durch den Staat stetig gestiegen ist. Von 67 Millionen Euro im Jahr 1960 sind die Zahlungen bis 2022 auf fast 600 Millionen Euro angewachsen. Umso tragischer erscheint es, dass die Kirchenvertreter nicht nur gegen die, von denen sie finanzielle Mittel beziehen, sondern auch gegen die Werte der Demokratie kämpfen, die sie vorggeben zu unterstützen.
Die Möglichkeit, dass kirchliche Akteure als Verfechter des Evangeliums wahrgenommen werden, schwindet zusehends, während sie in praktischer Inszenierung als einseitige politische Akteure auftreten. Daher wäre es an der Zeit, die Debatte über die Trennung von Kirche und Staat neu zu beleben und zu fragen, inwiefern die aktuelle Ausrichtung der Kirchen mit den ethischen und moralischen Grundsätzen des Christentums vereinbar ist.