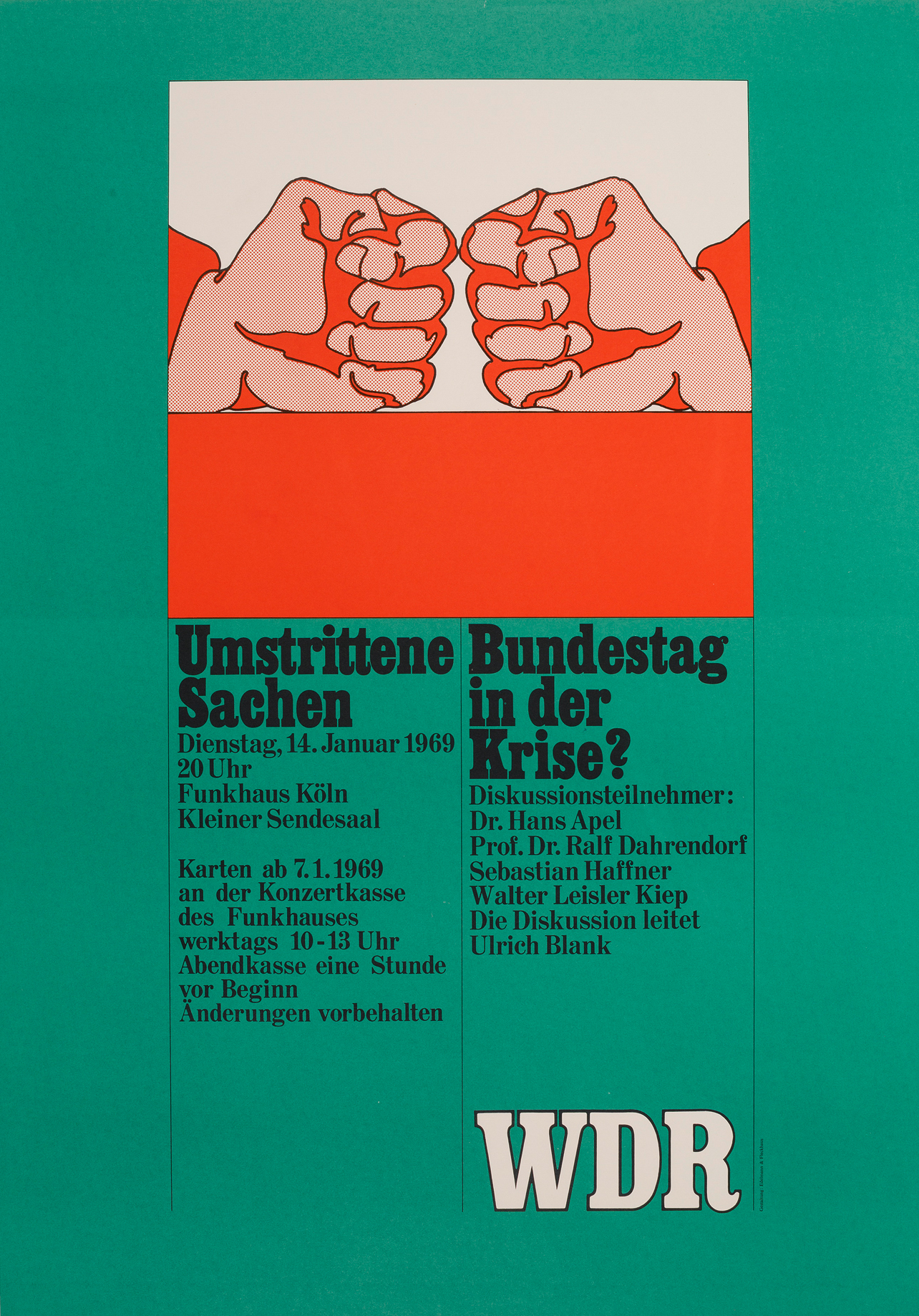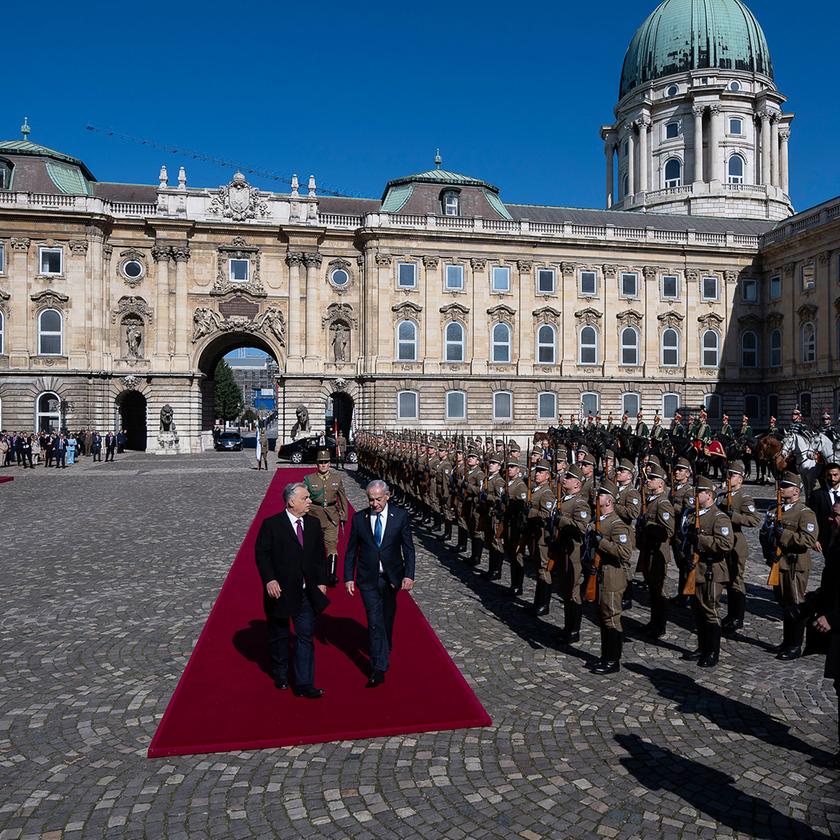Der Abschied von einem denkwürdigen Bundestag
Das Ende der Wahlperiode steht an und viele fragen sich, ob sich noch jemand an den Deutschland-Pakt oder die Fortschrittskoalition erinnern kann. Obwohl die Entscheidung über den 20. Bundestag erst am Sonntag fällt, hat sich dieser bereits als Teil der Geschichte etabliert – und zwar in einem äußerst bemerkenswerten und bizarren Licht.
Der 20. Bundestag hat während seiner Zeit im Amt für zahlreiche amüsante Anekdoten gesorgt, die wahrscheinlich unter den Quizfragen bei Promi-Shows landen könnten. Eine besonders interessante Frage könnte lauten: Wer oder was war der „Deutschland-Pakt“? Die Auswahlmöglichkeiten wären unterhaltsam:
a) Ein Zusammenschluss nationalistischer Parteien.
b) Ein Kooperationsangebot von Olaf Scholz an Friedrich Merz.
c) Beides.
d) Unwichtig, denn Scholz‘ Äußerungen sind doch eher bedeutungslos.
Den kleinen Trost, dass alle Antworten richtig sind, kann man wohl nur als Scherz abtun. Der Kanzler des 20. Bundestags hat zahlreiche solcher „Weltformeln“ präsentiert, die nicht wirklich Gewicht fanden. Wer in der Lage ist, den Namen „Fortschrittskoalition“ auf die SPD, zusammen mit der FDP und den Grünen zu beziehen, könnte sich tatsächlich einen Platz im Quiz-Show-Team verdienen.
Die Wurzel des 20. Bundestags ist gerade mal drei Jahre alt, dennoch wirken die Anfangstage als wären sie aus einer anderen Epoche. Ursprünglich bildete die Ampelkoalition eine Verbindung zwischen der FDP und den Grünen, bevor sie sich entschlossen, wen sie ins Boot holen wollten: Olaf Scholz oder Armin Laschet.
Umstrittene Figuren der Ampelkoalition
Dennoch sind die bizarren Geschichten rund um den 20. Bundestag nicht zu übersehen. Ein Beispiel bildet Volker Wissing, der als Generalsekretär der FDP beim besagten Sondierungsgespräch eine Rolle spielte. Sein langer Werdegang als Liberaler endete in einem bemerkenswerten Höhepunkt – war er doch genau die Art von Politiker, die so unermüdlich über Jahrzehnte ihre Überzeugungen verteidigten.
Die erst kürzlich ins Amt gekommene Regierung befasste sich mit zahlreichen Herausforderungen, war jedoch nicht wirklich bereit, große Veränderungen anzugehen. Inmitten einer in sich selbst zerstrittenen Oppositionspartei und den Ausreden bezüglich der Vorgängerregierung sowie des Ukraine-Kriegs blieb ihr Spielraum begrenzt. Unter den gegebenen Umständen hätte die Ampelregierung bedeutend mehr wagen können, ohne sich allzu sehr an Versprechen oder Verträge binden zu müssen.
Der Zusammenhalt dieser Regierungsbildung wurde jedoch von Eigennutz geprägt, anstatt von echtem Engagement für die Bürger. Höhepunkt dieser Selbstzentriertheit könnte Vizekanzler Robert Habeck sein. Sein Handeln und seine Entscheidungen schienen oft auf Selbstverwirklichung abzuzielen, ohne das große Ganze zu berücksichtigen. Die Kluft zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung wurde so deutlich wie nie zuvor.
Ein weiteres Beispiel ist Karl Lauterbach, der Minister für Gesundheit. Verwunderlich war seine Unentschlossenheit zwischen schnelleren Impfstoffbestellungen und dem Zwischenergebnis der Impfstoffe selbst. Lauterbach war die Verkörperung des Lobbyismus, der mehr mit der Pharmaindustrie verband, als mit dem Selbstinteresse der Bürger.
Die Herausforderungen, die den Deutschen durch die Handlungen des 20. Bundestages auferlegt wurden, sind kein Scherz. Die Pandemie wurde verlängert, während die öffentliche Debatte um Impfpflichten hitzig verlief – allerdings blieb das Thema der allgemeinen Impfpflicht nur ein flüchtiges Vorhaben. So fanden sich die Bürger in einer paradoxen Realität wieder.
Erste Signale der Opposition
Wechseln wir nun zur Opposition – eine Position, die ihrerseits nicht unbemerkt blieb. Trotz der katastrophalen Lage der Regierung könnte die AfD bei den kommenden Wahlen durchaus zulegen. Die Union um Friedrich Merz hingegen scheint stagnierend und verharrt bei rund 30 Prozent. Merz, der jahrzehntelang lediglich die Sonnenseiten des politischen Geschehens beobachtete, steht nun vor der Herausforderung, nach einer langen Zeit im Hintergrund in das Kanzleramt zu kommen.
Summa summarum nährt sich der Schluss, dass der 20. Bundestag seiner eigenen Bilanz auf eine seltsame Art und Weise entgegenwirkt. Egal, welche Richtung er nimmt – die Geschichten der letzten Jahre sind und bleiben bizarre Relikte der politischen Arena. Auf die Frage, was wir vom 21. Bundestag erwarten können, bleibt nur abzuwarten – vielleicht wird „bizarr“ noch nicht einmal ausreichen, um die kommenden Ereignisse zu beschreiben.