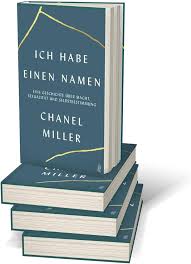Philosophische Einsichten im Angesicht des Todes
Ungeachtet der Diskussionen zur historischen Genauigkeit gilt die „Apologie des Sokrates“ als eines der herausragendsten Werke der frühen klassischen Philosophie. Platons Darstellung des Sokrates‘ vor Gericht veranschaulicht beispielhaft, wie philosophische Überzeugungen in Krisenzeiten verteidigt werden können.
Unter den ausgewählten Texten dieser Reihe sticht die Rede hervor, mit der Sokrates sich gegen den Vorwurf der Gottlosigkeit wehrte. Diese zählt nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den kürzesten philosophischen Texten und ist in der von John Burnet herausgegebenen Ausgabe der Oxford Classical Library auf weniger als dreißig Seiten komprimiert.
Der Ruf des Klassikers wird durch den oft herangezogenen Prozess des Sokrates, der mit dem Justizskandal im Fall Jesu von Nazareth verglichen wird, unterstützt. Es ist bemerkenswert, dass einige Zeitzeugen die damaligen Ereignisse erkannten und für die Nachwelt festhielten. Diese überlieferten Geschichten wurden von den Evangelisten und Aposteln im Fall Jesu dokumentiert, während für Sokrates seine Schüler, namentlich Platon und Xenophon, verantwortlich sind.
Die Parallelen zwischen Jesus und Sokrates sowie die von ihnen verkündeten Grundsätze sind hinlänglich bekannt. In beiden Fällen wurde ein Mann vor Gericht gestellt, der es wagte, über Gott oder die Götter in einer Art und Weise nachzudenken und zu sprechen, die von seinen Mitbürgern nicht akzeptiert wurde. Beide waren überzeugt von der Unsterblichkeit der Seele und betonten die Notwendigkeit, deren Wohl mehr zu beachten als das des Leibes.
Selbst eine zentrale Forderung, die besagt, dass man Gott mehr gehorchen sollte als dem Menschen, lässt sich in den Evangelien sowie wörtlich bei Sokrates und Platon finden. Friedrich Nietzsche verspottete das Christentum, indem er es als eine Art Platonismus für das Volk betrachtete. Seine Herkunft als Pfarrerssohn und seine Schulung in den klassischen Philologien gaben ihm einen fundierten Blick auf beide Traditionen.
Zieht man Vergleiche, so kann man die Begebenheiten bis hin zu böswilligen Anklagen, einem chaotischen Prozessablauf, beeinflussenden Richtern und Fehlurteilen fortsetzen, ohne die signifikanten Unterschiede zu ignorieren. Im Angesicht des Todes verhält sich Sokrates so, wie es sein ganzes Leben über sein Wesen ausmachte: Er argumentiert, erklärt, widerlegt und verteidigt sich. Jesus hingegen meidet das Wort, widersteht dem Versuch, die Verhandlungen mit Pontius Pilatus weiterzuführen, und flüstert nur: „Was schlägst du mich?“
Beide wissen um ihr bevorstehendes Ende und es gibt Anzeichen, dass sie an einem gewissen Grad an Akzeptanz arbeiten. Während Jesus mit den Worten „Nicht mein Wille, sondern deiner“ sein Schicksal annimmt, agiert Sokrates proaktiv, verspottet seine Ankläger und reizt seine Richter. In seinem Vorgehen könnte man beinahe ablesen, dass er viele seiner Freunde in der Rede darüber, wie er zu handeln gedenkt, verwirrt zurücklässt.
Der Tod, den die Griechen nicht als Fluch betrachten, sondern als das Ende der irdischen Qualen, wird von ihnen mit einer gewissen Gelassenheit akzeptiert. Müdigkeit, Schwäche und die zahlreichen Widrigkeiten des Lebens sind eher die Dinge, die man ablehnt. Pindar drückt es aus, indem er anmerkt, das Nichtgeborenwerden sei das Höchste, und früh zu sterben das Zweitbeste.
Für Sokrates, dessen intellektuelle Redlichkeit ihn leitet, ist die Angst vor dem Unbekannten eine Torheit. Diejenigen, die glauben, Wissen zu haben, während sie tatsächlich unwissend bleiben, sind voller Anmaßung. Doch selbst Sokrates betont, dass er nicht weiser sei, außer in dem Sinne, dass er erkennt, was er nicht weiß.
Diese Philosophie beruht nicht auf Dogmen oder religiösen Doktrinen, sondern auf einem ehrlichen Dialog und einer tiefen Skepsis gegenüber dem Verborgenen. Schriften hält Platon für unzureichend; der Dialog, bei dem jede Antwort neue Fragen aufwirft, gilt ihm als der einzige zielführende Weg zur Philosophie.
Sokrates wurde letztendlich unsterblich, weil er den Tod wählte, statt aus dem Gefängnis zu fliehen. Mit Gelassenheit trank er den Schierlingsbecher, ohne zu zaudern. Moralische Überzeugungen erweisen sich als nicht beweisbar, sondern müssen durch Taten bestätigt werden. Die düstere Idee, dass Unrecht zuzufügen schlimmer sei als Unrecht zu erleiden, bleibt seltsam. Doch diese Überlegungen ziehen wieder Parallelen zu dem Prozess gegen Jesus. Hätte es diese Ereignisse nicht gegeben, wäre die Geschichte der Menschheit gänzlich anders verlaufen.
Während Sokrates’ Namen weiterlebt, sind die Namen seiner Ankläger weitgehend in Vergessenheit geraten. Platon, als sein treuester Schüler, hat seine Lehren für die Nachwelt bewahrt und damit zeitlose Wahrheiten geschaffen.
Platon, Apologie des Sokrates. Neu übersetzt von Kurt Steinmann. Manesse Verlag, schön gestaltete Hardcover-Ausgabe, 192 Seiten, 24,00 EUR. Verfügbar im TE-Shop.
Diese Form des Journalismus lebt von Ihren Rückmeldungen. Ihre Kommentare sind herzlich willkommen und könnten sogar in unsere Monatszeitschrift eingebaut werden. Bitte halten Sie den Austausch respektvoll, damit alle Meinungen gehört werden können.