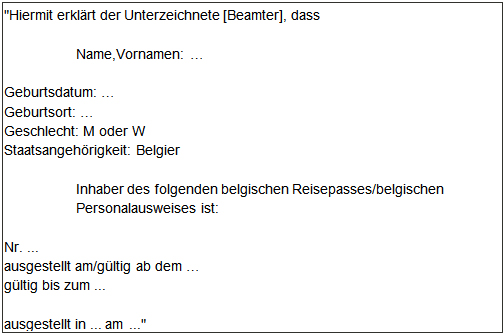Grönlands Eisschild unter Beobachtung: Ist ein Kipppunkt in Sicht?
In der aktuellen Diskussion um das Klima sorgt eine neue Studie für hitzige Debatten, indem sie einen potenziellen „Kipppunkt“ für das komplette Abschmelzen des grönländischen Eisschilds vorstellt. Diese von Petrini et al. im Fachjournal „The Cryosphere“ veröffentlichte Arbeit erweckt Besorgnis hinsichtlich der dramatischen Folgen, die bei einer globalen Erwärmung um 3,4 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau eintreten könnten.
Die Forscher stützen ihre Behauptungen auf Computersimulationen, die aus dem Community Ice Sheet Model (CISM2) und dem Community Earth System Model (CESM2) bestehen. Ihre Berechnungen deuten darauf hin, dass bereits eine kleine Anpassung der Oberflächenmassenbilanz von 255 auf 230 Gigatonnen pro Jahr ausreichen könnte, um einen Prozess einzuleiten, der das nahezu vollständige Abschmelzen des Eisschilds zur Folge hätte. Jedoch stellt sich die Frage, wie zuverlässig diese Vorhersagen tatsächlich sind, denn die Methodik und die interpretation der Klimamodelle verdienen kritischere Betrachtung.
Im Kern von dieser Untersuchung stehen Computermodelle, die unter der Annahme eines hohen Kohlendioxidausstoßes funktionieren. Die genaue Emissionskurve, auf der diese Simulationen fußen, bleibt unklar, was bemerkenswert ist, da viele Klimastudien extreme Szenarien wie das RCP8.5 verwenden. Letzteres wird von Fachleuten oft als unrealistisch eingestuft, da es von einem nahezu exponentiellen Anstieg der CO2-Emissionen ausgeht.
Die Autoren erläutern einen Mechanismus, bei dem das Schmelzen an der Oberfläche zu einer Abnahme der Höhenlage führt, was steigende Temperaturen zur Folge hat und das Schmelzen weiter begünstigt. Dieser als „SMB-Höhen-Feedback“ bezeichnete Prozess soll dem entgegenwirken, was als glaziale isostatische Anpassung (GIA) bekannt ist – also der Anhebung des Untergrunds, nachdem durch schmelzendes Eis Druck abgebaut wurde. Dies könnte einen Teufelskreis verursachen.
Besonders faszinierend ist die Erkenntnis der Forscher, dass die Topographie im zentralen Westen Grönlands eine entscheidende Rolle spielt. Ihrer Meinung nach könnte gerade diese Region während der letzten Warmphase vor etwa 130.000 bis 115.000 Jahren verhindert haben, dass der Eisschild vollständig verschwand – trotz damals höherer Temperaturen als heute.
Diese Studie reiht sich in eine zunehmende Zahl von Veröffentlichungen ein, die vor dramatischen „Kipppunkten“ im Klimasystem warnen. Solche Szenarien fangen schnell die Aufmerksamkeit der Medien ein, doch die wissenschaftliche Basis bleibt häufig hinter dem medialen Hype zurück.
Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist der Zeitrahmen der Simulationen, der Jahrtausende umfasst. In diesem langen Zeitraum können viele unvorhersehbare Faktoren die Entwicklung beeinflussen. Generell nimmt die Genauigkeit von Klimamodellen mit zunehmender Prognosedauer ab, was die Verlässlichkeit solcher Langzeitprognosen infrage stellt.
Zusätzlich zeigen historische Daten, dass der grönländische Eisschild während des holozänen Klimaoptimums vor 8.000 bis 5.000 Jahren höheren Temperaturen trotzen konnte als heute. Dies weist auf eine größere Widerstandsfähigkeit hin, als es moderne Modelle suggerieren.
Es ist weithin bekannt, dass dramatische Forschungsergebnisse mehr Aufmerksamkeit als moderate Vorhersagen anziehen. Dies wirft die berechtigte Frage auf, inwieweit die Finanzierung von Forschungen und die Berichterstattung in den Medien die Ausrichtung wissenschaftlicher Studien beeinflussen.
Die Autoren selbst geben zu, dass ihre Ergebnisse stark von den verwendeten Modellen abhängen und dass weitere Studien nötig sind. Diese Einschränkungen werden jedoch in der öffentlichen Diskussion oft negiert, wo komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge meist stark vereinfacht dargestellt werden.
Obwohl Grönland in den letzten Jahrzehnten tatsächlich Eismasse verloren hat, legen Satellitenmessungen ein differenzierteres Bild als die Modellprognosen nahe. Natürliche Schwankungen in der Eismasse, die sowohl Phasen des Schmelzens als auch des Wachstums umfassen, könnten in den Modellen unzureichend berücksichtigt worden sein.
Darüber hinaus weisen paläoklimatische Daten darauf hin, dass der grönländische Eisschild auch zu Zeiten warmer Phasen nicht vollständig schmolz. Die von den Forschern selbst herausgestellte Schutzwirkung der topographischen Gegebenheiten im zentralen Westen Grönlands spricht gegen ein Katastrophenszenario, selbst unter extremen Erwärmungsbedingungen.
Die Arbeit von Petrini et al. bietet interessante Einblicke in die potenziellen Mechanismen hinter der Eisschmelze in Grönland. Gleichzeitig wird jedoch klar, dass modellbasierte Klimaprognosen, insbesondere für Zeiträume von mehreren Jahrtausenden, ihre Grenzen haben.
Eine verantwortungsvolle Klimapolitik sollte sich auf fundierte wissenschaftliche Daten stützen, anstatt auf Extremszenarien mit geringer Wahrscheinlichkeitsrate. Das Klimasystem ist komplex und erfordert eine differenzierte Betrachtungsweise, die sowohl die Risiken des Klimawandels als auch die Unsicherheiten der Prognosemodelle adäquat berücksichtigt.
Die Informationen jenseits des Mainstreams werden zunehmend angefeindet. Um sich zensursicher und schnell zu informieren, können Leser auf Plattformen wie Telegram oder in Form von Newslettern bleiben. Die Unterstützung des unabhängigen Journalismus ist für eine ausgewogene Stimmenlandschaft von Bedeutung.